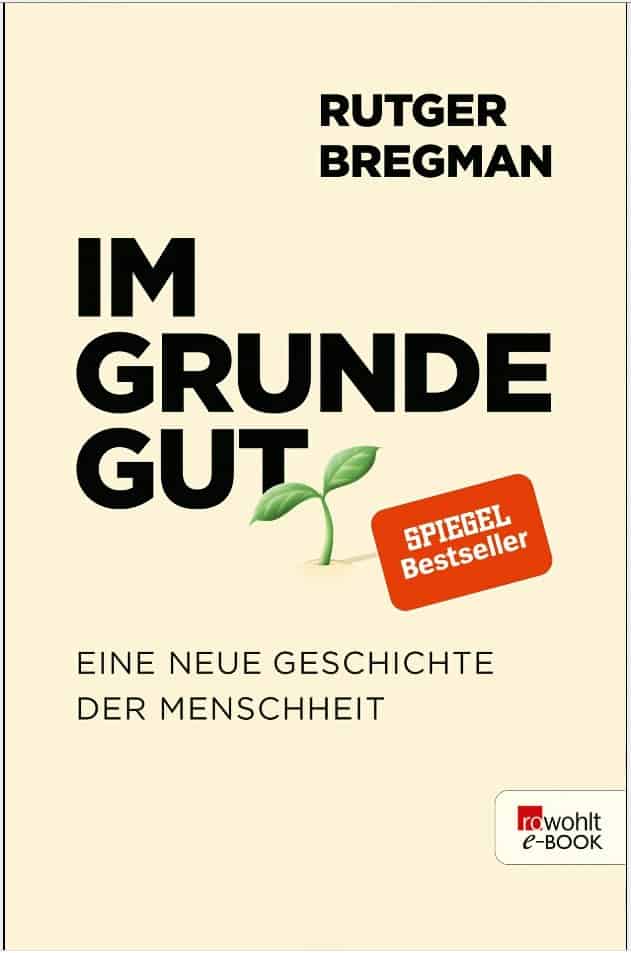 Das Buch „Im Grunde gut: Eine neue Geschichte der Menschheit“ von Rutger Bregman hat eine hohe Relevanz für die Bewältigung von strategischen Schocks wie einem möglichen Blackout. Dies auch, weil es hier zahlreiche Katastrophenmythen rund um das erwartete Verhalten von Menschen in Krisen gibt. Besonders erschütternd ist, dass viele populäre wissenschaftliche Erkenntnisse, wie etwa das bekannte Milgram oder das Stanford-Prison-Experiment als Mythos und manipuliertes Experiment widerlegt werden. Trotzdem dienen viele dieser bekannten „wissenschaftlichen Experimente“ weiterhin als Basis für weitreichende Entscheidungen oder für gängige Narrative. Daher kann dieses Buch einigen Zweifel auslösen.
Das Buch „Im Grunde gut: Eine neue Geschichte der Menschheit“ von Rutger Bregman hat eine hohe Relevanz für die Bewältigung von strategischen Schocks wie einem möglichen Blackout. Dies auch, weil es hier zahlreiche Katastrophenmythen rund um das erwartete Verhalten von Menschen in Krisen gibt. Besonders erschütternd ist, dass viele populäre wissenschaftliche Erkenntnisse, wie etwa das bekannte Milgram oder das Stanford-Prison-Experiment als Mythos und manipuliertes Experiment widerlegt werden. Trotzdem dienen viele dieser bekannten „wissenschaftlichen Experimente“ weiterhin als Basis für weitreichende Entscheidungen oder für gängige Narrative. Daher kann dieses Buch einigen Zweifel auslösen.
Natürlich darf man dabei auch nicht in eine Naivität verfallen. Es geht auch nicht um Entweder-oder, sondern um ein Sowohl-als-auch-Denken! Es gibt immer einen Kipppunkt, der heute im Fall eines Blackouts aufgrund der mangelhaften Vorsorge eher früher als später eintreten würde. Aber zunächst ist durchaus von einer Kooperationsbereitschaft auszugehen, welche auch zu fördern ist. Eine große Gefahr sehe ich in der Krisenkommunikation, welche von der falschen Seite oder mit dem falschen Wording rasch zu einer Eskalation führen kann. Eine Deeskalation wird nur durch eine fundierte Vorbereitung gelingen, welche mit einer derzeit fehlenden Sicherheitskommunikation beginnt.
Der Autor und gewisse Aussagen sind auch nicht unumstritten. Aber auch hier gilt es, sich interessante Aspekte herauszunehmen und in eigene Überlegungen einzubauen. Oder wie Alex dazu meint: „Es ist eine Frage des Kontextes, der Zeitlichkeit und, ich glaube, zu einem gewissen Maße auch der Kultur. Wir fokussieren uns zu sehr auf das Negative, zu wenig auf die positiven Veränderungen usw.“
Hier einige wichtige Zitate:
Erfahrungen aus dem 2. Weltkrieg
Und die mentale Verwüstung? Die Millionen an traumatisierten Opfern, vor denen die Experten gewarnt hatten? Nirgends zu entdecken. Natürlich gab es viel Kummer und Wut. Natürlich gab es tiefe Trauer um die umgekommenen Angehörigen. Aber die psychiatrischen Notaufnahmen blieben leer. Mehr noch, mit der mentalen Gesundheit vieler Briten ging es bergauf. Der Alkoholmissbrauch nahm ab. Weniger Menschen als in Friedenszeiten begingen Selbstmord. Nach dem Krieg sehnten sich viele Briten sogar nach der Zeit des Luftkrieges zurück, als jeder jedem half und es keine Rolle spielte, ob man links oder rechts, arm oder reich war. «Die britische Gesellschaft wurde durch den Luftkrieg in vielerlei Hinsicht stärker», schrieb ein britischer Historiker später.
Die Notsituation hatte nicht das Schlechteste im Menschen hervorgeholt. Das britische Volk stieg auf der Zivilisationsleiter ein paar Stufen hinauf.
Wie Gustave Le Bon hatte er keine hohe Meinung vom einfachen Volk; er hielt es für feige und zur Panik neigend.
In Dresden starben in nur einer Nacht fast so viele Männer, Frauen und Kinder wie in London während des gesamten Krieges. Über die Hälfte der deutschen Städte wurde zerstört. Von einer Massenpanik konnte nirgends die Rede sein. Die Einwohner, die zum ersten Mal bombardiert wurden, reagierten sogar mit gegenseitiger Unterstützung. «Die nachbarliche Hilfsbereitschaft war groß», bemerkte Panse.
Die Bombardements seien ein Fiasko gewesen. Die deutsche Kriegswirtschaft sei daraus wahrscheinlich eher gestärkt hervorgegangen, weshalb der Krieg länger gedauert haben dürfte. Zwischen 1940 und 1944 hatte sich die Produktion deutscher Panzer um den Faktor neun erhöht. Die von Kriegsflugzeugen sogar um den Faktor vierzehn. Ein britisches Team von Ökonomen kam zu dem gleichen Ergebnis. In den 21 zerstörten Städten, die sie untersuchten, war die Produktion schneller gewachsen als bei einer Kontrollgruppe von 14 Städten, die nicht bombardiert worden waren.
Das Faszinierende daran ist, dass alle den gleichen Fehler begingen. Hitler und Churchill, Roosevelt und Lindemann – sie alle teilten das Menschenbild von Gustave Le Bon, dem Psychologen, der behauptet hatte, dass die menschliche Zivilisation nur von einer dünnen Schicht geschützt würde. Sie waren davon überzeugt, dass die Luftwaffe diese Schicht zerstören würde. Aber je mehr Bomben fielen, desto dicker wurde die Schicht.
Häutchen hatte sich zu einer Hornhaut verhärtet. Dennoch fand diese Schlussfolgerung bei den Militärexperten kaum Gehör. 25 Jahre später warfen die Amerikaner dreimal so viele Bomben auf Vietnam wie auf Deutschland während des gesamten Zweiten Weltkriegs. Daraus resultierte bekanntermaßen ein noch größerer Fehlschlag. Selbst wenn der Beweis direkt vor unseren Füßen liegt, schaffen wir es immer wieder, uns selbst zum Narren zu halten.
Ich kenne niemanden, der diese Idee besser erklären könnte als Tom Postmes, Professor für Sozialpsychologie in Groningen. Seit Jahren stellt er seinen Studenten immer die gleiche Frage: Ein Flugzeug muss notlanden und bricht in drei Teile. Die Kabine füllt sich mit Rauch. Allen Insassen ist klar: Wir müssen hier raus. Was passiert? Auf Planet A fragen die Insassen einander, ob es ihnen gutgehe. Personen, die Hilfe benötigen, bekommen den Vortritt. Die Menschen sind bereit, ihr Leben zu opfern, auch für Fremde. Auf Planet B kämpft jeder für sich allein. Totale Panik bricht aus. Es wird getreten und geschubst. Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen werden niedergetrampelt. Frage: Auf welchem Planeten leben wir? «Ungefähr 97 Prozent glauben, dass wir auf Planet B leben», sagt Postmes. «Aber tatsächlich leben wir auf Planet A.» Es spielt keine Rolle, aus welchem Milieu die Befragten kommen. Linke und Rechte, Arme und Reiche, Ungebildete und belesene Menschen – jedem unterläuft der gleiche Fehler in der Beurteilung. «Erstsemester wissen es nicht, Drittsemester auch nicht, Masterstudenten nicht, und auch viele Profis liegen falsch, selbst Katastrophenschutzkräfte haben keine Ahnung», seufzt Postmes.
Untergang der Titanic: Aber nein, es wurde nicht rumgeschubst oder -gezerrt. Ein Augenzeuge berichtete, dass es gab, «keine Angstschreie und kein Hin- und Hergerenne». Oder denken Sie an den 11. September 2001. Tausende von Menschen liefen geduldig die Treppen der Twin Towers hinunter, obwohl sie genau wussten, dass ihr Leben in Gefahr war. Feuerwehrleuten und Verletzten wurde der Vortritt gewährt.
Dass Menschen von Natur aus egoistisch, panisch und aggressiv sind, ist ein hartnäckiger Mythos. Der Biologe Frans de Waal spricht deshalb von einer «Fassadentheorie». Die Zivilisation wäre demnach eine dünne Fassade, die beim geringsten Anlass einstürzen würde .Die Geschichte lehrt uns aber das genaue Gegenteil: Gerade, wenn Bomben vom Himmel fallen oder Deiche brechen, kommt das Beste in uns zum Vorschein.
Hurrikan Katrina, 2005
Erst Monate später, als die Journalisten verschwunden waren, das Wasser abgepumpt war und sich die Kolumnisten einem neuen Thema zugewandt hatten, fanden Wissenschaftler heraus, was wirklich in New Orleans geschehen war. Die Schüsse des Scharfschützen waren in Wahrheit das Ventilgeklapper eines Gastanks. Sechs Menschen waren im Superdome-Stadion gestorben: vier auf natürliche Weise, einer an einer Überdosis und einer durch Selbstmord. Der Polizeichef musste zugeben, dass es keinen einzigen offiziellen Bericht über Morde oder Vergewaltigungen gab. Und tatsächlich: Es war viel geplündert worden, aber vor allem von Gruppen, die gemeinsame Sache machten, um ihr Überleben zu sichern, manchmal sogar zusammen mit der Polizei. Wissenschaftler am Disaster Research Center der University of Delaware schlossen daraus, dass
Das Disaster Research Center hat seit 1963 auf der Grundlage von fast 700 Feldstudien festgestellt, dass, im Gegensatz zu Darstellungen in den meisten Spielfilmen, nach einer Katastrophe nie die totale Panik ausbricht und auch keine Welle des Egoismus aufbrandet. Die Zahl der Verbrechen – Mord, Diebstahl, Vergewaltigung – nimmt in der Regel ab. Die Menschen bleiben ruhig, geraten nicht in Panik und handeln schnell. «Und egal, wie viel geplündert wird», stellt einer der Wissenschaftler fest, «es verblasst immer im Vergleich zu dem weitverbreiteten Altruismus, der zu einem großzügigen und umfangreichen Geben und Teilen von Gütern und Diensten führt.» In Notsituationen kommt das Beste im Menschen zum Vorschein.
Aber die Dynamik von Katastrophen ist immer dieselbe. Ein kollektiver Schicksalsschlag trifft eine Gemeinschaft, die Menschen beginnen einander zu helfen und sich zu solidarisieren, die zuständigen Oberen geraten in Panik, und dann erst tritt die zweite Katastrophe ein. Könige und Diktatoren, Gouverneure und Generäle glauben, dass die einfachen Menschen egoistisch sind, weil sie selbst es so oft sind. Sie greifen zu Gewalt, weil sie etwas verhindern wollen, das sich allein in ihrer Phantasie abspielt.
Und das ultimative Placebo? Operieren! Ziehen Sie sich einen weißen Kittel an, sorgen Sie für eine Narkose, trinken Sie eine Tasse Kaffee und erzählen Sie Ihrem Patienten beim Aufwachen, dass die Operation einen atemberaubenden Erfolg gehabt hat. Eine große Übersichtsstudie im British Medical Journal, in der echte Operationen bei Rückenschmerzen oder Sodbrennen mit einem solchen Als-ob-Spiel verglichen wurden, ergab, dass das Placebo in drei Vierteln der Fälle wirkte. Bei der Hälfte sorgte das Placebo sogar für eine vergleichbare Schmerzlinderung wie ein tatsächlich durchgeführter Eingriff.
Warnen Sie Ihre Patienten vor schwerwiegenden Nebenwirkungen, und sie werden sofort Beschwerden wahrnehmen.
Wenn der Nocebo-Effekt uns etwas lehrt, dann, dass Ideen nicht einfach nur Ideen sind. Was wir glauben, bestimmt, was wir werden. Was wir suchen, bestimmt, was wir finden. Was wir vorhersagen, bestimmt, was tatsächlich eintritt.
Unser negatives Menschenbild ist ebenfalls ein Nocebo. Wenn wir glauben, dass die meisten Menschen im Grunde nicht gut sind, werden wir uns gegenseitig auch dementsprechend behandeln. Dann fördern wir das Schlechteste in uns zutage.
Letztlich gibt es nur wenige Vorstellungen, die die Welt so sehr beeinflussen wie unser Menschenbild. Was wir voneinander annehmen, ist das, was wir hervorrufen.
In diesem Buch werde ich nicht behaupten, dass wir alle uneingeschränkt gut sind. Menschen sind keine Engel. Wir haben eine gute und eine schlechte Seite, die Frage ist, welche Seite wir stärken wollen.
Ein Großvater sagte einst zu seinem Enkel: «In mir findet ein Kampf statt, ein Kampf zwischen zwei Wölfen. Einer ist schlecht, böse, habgierig, eifersüchtig, arrogant und feige. Der andere ist gut– er ist ruhig, liebevoll, bescheiden, großzügig, ehrlich und vertrauenswürdig. Diese Wölfe kämpfen auch in dir und in jeder anderen Person.» Der Junge dachte einen Moment nach und fragte dann: «Welcher Wolf wird gewinnen?» Der alte Mann lächelte. «Der Wolf, den du fütterst.»
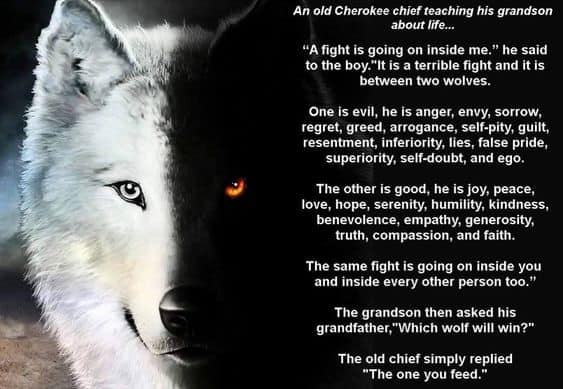
Es stellte sich heraus, dass wir darauf trainiert sind, überall Egoismus zu wittern.
Die Frage, die mich seit Jahren fasziniert, ist, warum wir die Welt so negativ sehen. Wie ist es möglich, dass so viele Menschen glauben, wir lebten auf Planet B, während doch so viele wissenschaftliche Beweise auf Planet A deuten?
Es gibt Dutzende Studien aus den Kommunikationswissenschaften, die belegen, dass Nachrichten der geistigen Gesundheit schaden.
Kürzlich wurde Menschen in 30 Länder eine einfache Frage gestellt: «Glauben Sie, dass sich die Welt verbessert, gleich bleibt oder sich verschlechtert?» In allen Ländern, von Russland bis Kanada, von Mexiko bis Ungarn, antwortete eine überwältigende Mehrheit, dass sich die Welt verschlechtere. In Wirklichkeit ist es angesichts wichtiger Kennzahlen genau umgekehrt. Die extreme Armut, die Anzahl der Kriegsopfer, die Kindersterblichkeit, die Kriminalitätsrate, der weltweite Hunger, die Kinderarbeit, die Anzahl der Todesfälle bei Naturkatastrophen und die Anzahl der Flugzeugabstürze sind in den letzten Jahrzehnten zurückgegangen. Wir leben in der reichsten, sichersten und gesündesten Ära aller Zeiten. Warum wir das nicht wissen? Ganz einfach: weil die Nachrichten die Ausnahmen präsentieren. Anschläge, Gewalt, Katastrophen: Je außergewöhnlicher ein Ereignis, desto nachrichtenwürdiger ist es.
Vor einigen Jahren untersuchte ein Team niederländischer Soziologen, wie Medien über Flugzeugabstürze berichten. Zwischen 1991 und 2015 ging die Zahl der Unfälle stetig zurück, die Aufmerksamkeit für Unglücke hingegen nahm zu. Das Ergebnis: Die Leute haben immer größere Angst, obwohl sie in zunehmend sicherere Flugzeuge einsteigen.
Das Gute im Menschen findet in der Zwischenzeit keinen Platz in der Berichterstattung. Denn gerade das Gute ist alltäglich.
Je größer der geistige Scharlatan, desto beharrlicher sein Bestehen auf der Niederträchtigkeit und Schwäche der menschlichen Natur.»
Wer sich für den Menschen einsetzt, tritt auch gegen die Mächtigen der Erde an. Für sie ist ein hoffnungsvolles Menschenbild rundherum bedrohlich. Staatsgefährdend. Autoritätsuntergrabend. Schließlich bedeutet es immer, dass wir keine egoistischen Tiere sind, die von oben herab kontrolliert, reguliert und dressiert werden müssen. Es könnte außerdem zur Folge haben, dass der Kaiser keine Kleider trägt, dass ein Unternehmen mit selbstmotivierten Mitarbeitern vielleicht gut ohne Manager auskommt und eine Demokratie mit engagierten Bürgern keine Politiker mehr benötigt.
So fußte die Wirtschaftswissenschaft von Anfang an auf einem Hobbes’schen Menschenbild: dem des rationalen, egoistischen Individuums. Rousseau dagegen ist enorm einflussreich auf die Pädagogik geblieben, weil er daran glaubte, dass Kinder so frei wie möglich aufwachsen sollten (ein revolutionärer Gedanke im 18. Jahrhundert). Bis in die Gegenwart sind Hobbes und Rousseau die gedanklichen Urväter der Konservativen und Progressiven, der Realisten und Idealisten geblieben. Wenn sich ein Idealist für mehr Freiheit und Gleichheit ausspricht, schaut Rousseau wohlwollend zu. Aber wenn ein Zyniker seufzt, dass dieser Freiheitsdrang zu mehr Gewalt führen kann, nickt Hobbes zustimmend.
Unsere Gehirne machen nur zwei Prozent unseres Körpergewichts aus, verbrauchen jedoch 20 Prozent der Kalorien, die wir zu uns nehmen.
Die gezüchteten, freundlichen Füchse erwiesen sich als unglaublich intelligent und viel klüger als ihre aggressiven Pendants. Oder wie Brian schrieb: «Die Füchse stellen meine Welt komplett auf den Kopf.»
Bis zu dieser Zeit war man davon ausgegangen, dass Domestizierung Tiere dümmer macht. Ihr Gehirn schrumpft, und die Fähigkeiten, die in der Wildnis nötig sind, gehen verloren. Man kennt die Klischees aus dem Sprachgebrauch: schlau wie ein Fuchs, dumm wie ein Schwein. Aber jetzt kam Brian zu einem ganz anderen Schluss.
Schimpansen und Orang-Utans erreichen bei fast allen mentalen Fähigkeiten ähnliche Ergebnisse wie zweieinhalbjährige Kinder. Aber in der Kategorie des social learning sind Kleinkinder in jeder Hinsicht überlegen. Die meisten Kinder erreichen 100 Prozent, die meisten Affen 0. Menschen scheinen supersoziale Lernmaschinen zu sein. Wir werden geboren, um zu lernen, uns miteinander in Verbindung zu setzen und zu spielen. Ist es dann noch verrückt, dass erröten ein einzigartiger, menschlicher Gesichtsausdruck ist? Erröten ist eine typische soziale Fähigkeit.
Wir sind darauf ausgerichtet, Verbindungen mit den Menschen unserer Umgebung herzustellen. Und das ist kein Handicap, sondern unser größtes Kapital. Soziale Menschen sind nämlich nicht nur eine nettere Gesellschaft, sie sind letztlich auch klüger.
Eigentlich waren die Neandertaler eine Art von Genies. Sie hatten eine größere individuelle, aber eine kleinere kollektive Hirnkapazität. Für sich allein war ein Homo neanderthalensis vielleicht klüger als ein Homo sapiens, aber dieser lebte eben in größeren Gruppen, wechselte diese Gruppe häufiger und konnte wahrscheinlich besser Dinge abschauen. Wenn Neandertaler ein rasend schneller Computer waren, dann waren wir ein altmodischer PC – aber mit WLAN. Wir waren dümmer, aber besser miteinander vernetzt.
Aber was ist mit den Neandertalern geschehen? Hat der Homo puppy sie doch abgeschlachtet?
Es ist wahrscheinlicher, dass wir Menschen gegen das raue Klima der letzten Eiszeit (die Geologen datieren sie auf etwa 115000 bis 15000 Jahre in der Vergangenheit) besser gewappnet waren, weil wir besser zusammengearbeitet haben.
Unsere «natürliche» Selbstsucht: heutzutage glaubt kaum noch ein Biologe daran. Kampf und Konkurrenz spielen eine klare Rolle in der Entwicklung des Lebens, aber jeder Erstsemesterbiologe lernt heutzutage, dass Zusammenarbeit viel ausschlaggebender ist. Eigentlich ist das eine alte Wahrheit. Unsere fernen Vorfahren stellten den Einzelnen selten auf ein Podest. Jäger und Sammler aus aller Welt, von den kältesten Tundren bis zu den heißesten Wüsten, glaubten, dass alles miteinander verbunden sei. Sie sahen den Menschen als Teil von etwas viel Größerem, das mit allen Tieren, Pflanzen und Mutter Erde zusammenhing.
Der Homo puppy ist nicht nur außergewöhnlich sozial, er kann auch unglaublich grausam sein. Warum?
Menschen sind Herdentiere – mit einer fatalen Einschränkung. Wir fühlen uns am stärksten von dem angezogen, was uns am ähnlichsten ist.
Oxytocin macht den Menschen sanfter, ruhiger und friedlicher. Es verwandelt den ungehobeltsten Rüpel in einen schwänzelnden Welpen.
Untersuchungen der Universität Amsterdam haben gezeigt, dass die Wirkung von Oxytocin sich oft auf die eigene Gruppe beschränkt. Während es unsere Liebe zu unseren Freunden vergrößert, kann es unsere Abneigung gegen Fremde zusätzlich verstärken. Oxytocin ist nicht das Hormon der universellen Bruderschaft, sondern das de «eigenen Volkes zuerst».
Soldaten & Krieg
Seit Jahrhunderten, nein, seit Jahrtausenden, haben Generäle und Minister, Schriftsteller und Künstler daran geglaubt, dass Soldaten kämpfen. Gerade in Kriegszeiten würde der Jäger in uns doch sicher wieder zutage treten. Dann tun wir, was wir gut können. Schießen, um zu töten. Doch als Marshall ein Gruppeninterview nach dem anderen führte, zuerst im Pazifik und später auch an der europäischen Front, stellte er fest, dass tatsächlich nur 15 bis 25 Prozent der Soldaten geschossen hatten. Die überwiegende Mehrheit dachte überhaupt nicht daran.
In der Nacht auf der Insel Makin befanden sich die Soldaten in einer besonders kritischen Lage. In einer solchen Situation würde man erwarten, dass jeder um sein Leben kämpft. Aber in Marshalls Bataillon, das mehr als 300 Soldaten stark war, hatte er nur 36 Männer finden können, die ihr Gewehr eingesetzt hatten. War es ein Mangel an Erfahrung? Nein. Viele Soldaten, die keinen Schuss abgaben, hatten sich gerade während der Ausbildung hervorgetan. Marshall konnte außerdem keinen Unterschied zwischen frischen und erfahrenen Truppen feststellen, wenn es um die Bereitschaft zum Schießen ging.
Nach dem Zweiten Weltkrieg begannen Historiker, Veteranen zu interviewen und stellten dabei fest, dass mehr als die Hälfte von ihnen noch nie jemanden getötet hatte. Die überwiegende Mehrheit der Opfer war einer kleinen Minderheit zuzurechnen. Zum Beispiel war weniger als ein Prozent der amerikanischen Jagdflieger für fast 40 Prozent der abgeschossenen Flugzeuge verantwortlich. Die meisten Piloten, so ein Historiker, hätte «nie jemanden abgeschossen oder auch nur einen Versuch dazu unternommen».
Nehmen Sie die Schlacht von Gettysburg (1863) während des Amerikanischen Bürgerkriegs. Im Anschluss an die Kampfhandlungen wurden genau 27574 Musketen gefunden. Aber mehr als 90 Prozent dieser Waffen waren noch geladen. Etwa 12000 Musketen waren doppelt geladen, die Hälfte davon mehr als dreifach.
Ich vertiefte mich in die akademische Literatur und stieß bald auf ein Muster. Wenn ein Wissenschaftler den Menschen als mordsüchtigen Affen darstellte, wurde diese Studie meist von Journalisten aufgegriffen. Aber wenn ein Kollege die Gewalttätigkeit des Menschen relativierte, fand das kaum Aufmerksamkeit. Und so fragte ich mich: Was, wenn unsere Sucht nach Spannung und Sensation uns einen Streich spielt? Was, wenn die Wissenschaft für etwas ganz anderes als die meistverkauften und meistgelesenen Studien steht?
Kurz gesagt, es besteht aller Grund zur Annahme, dass unsere entfernten Ureltern einen großen Freundeskreis unterhielten. Wer immer wieder auf neue Menschen trifft, lernt immer wieder neue Dinge. Nur so konnten wir schlauer werden als die Neandertaler.
Hatte Jean – Jacques Rousseau recht? Ist es wahr, dass der Mensch von Natur aus gut ist und dass alles erst mit der Entstehung der Zivilisation schiefging, als wir an einem Ort sesshaft wurden? Das erscheint mir immer plausibler.
Aufsparen und Horten waren bei Jägern und Sammlern tabu. Zum größten Teil unserer Geschichte haben wir nicht Besitztümer angehäuft, sondern Freundschaften. Die europäischen Entdeckungsreisenden waren immer wieder erstaunt über die Freigebigkeit der Menschen, die sie trafen «Wenn man sie etwas fragt, sagen sie niemals nein», schrieb Kolumbus in sein Logbuch «Im Gegenteil, sie teilen mit allen …»
Während Eltern heutzutage ihrem Nachwuchs einschärfen, Fremden zu misstrauen, wurde in prähistorischen Zeiten Vertrauen förmlich mit der Muttermilch aufgesogen.
Warum waren Jäger und Sammler in der Lage, mit arroganten Führern kurzen Prozess zu machen, während wir sie heute einfach nicht loswerden können?
Es gibt viele Beispiele von Völkern, die ohne strenge Hierarchie Tempel gebaut oder sogar ganze Städte aus dem Boden gestampft haben. 1995 gruben Archäologen in der Südtürkei einen riesigen Tempelkomplex mit prächtig bearbeiteten Säulen mit einem Gewicht von jeweils mehr als 20 Tonnen aus. Eine Art Stonehenge, aber viel beeindruckender. Als es um das Datieren der Säulen ging, entdeckten die Wissenschaftler etwas Bizarres. Die Monumente waren mehr als 11000 Jahre alt. Sie wurden nicht von Bauern (unter der Aufsicht von Königen und Bürokraten) errichtet, sondern von Jägern und Sammlern. Tausende Menschen müssen am Bau des Göbekli Tepe mitgewirkt haben, wie dieser älteste Tempel der Welt heißt.
Mit den ersten Siedlungen und der Erfindung des Privateigentums begann eine neue Ära in der Menschheitsgeschichte. Ein Prozent würde die restlichen 99 Prozent unterdrücken. Großmäuler wurden zuerst Kapitäne, dann Generäle, erst Häuptlinge, dann Könige. Die Ära der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit war dahin.
Was wir heutzutag «Meilensteine der Zivilisation»nennen – die Erfindung von Geld, Schrift und Rechtsprechung –, waren ursprünglich Meilensteine der Unterdrückung. Nehmen wir die ersten Münzen. Geld wurde nicht spontan erfunden, weil es so nützlich zu sein schien, sondern von oben oktroyiert, um Steuern erheben zu können. Oder die Schrift: Sie glauben doch nicht etwa, dass in den ersten Büchern romantische Poesie gestanden hätte. Die frühesten Texte waren lange Listen von Schulden, die abgezahlt werden mussten.
Und der Rechtsstaat? Der berühmte Kodex Hammurabi (das älteste Gesetzbuch) beinhaltete vor allem Strafen für diejenigen, die Sklaven zur Flucht verhalfen.
Das antike Athen, die Wiege unserer Zivilisation und Demokratie, bestand zu zwei Dritteln aus Sklaven. Große Philosophen wie Platon und Aristoteles waren gar davon überzeugt, dass eine Zivilisation ohne Sklaverei unmöglich wäre.
Warum ist unser Bild von de «Barbaren»so lange negativ gewesen? Warum halten wir Jahrhunderte ohn «Zivilisation»automatisch für dunkle Zeiten? Denken wir daran, dass die Geschichte von den Siegern geschrieben wird. Die ältesten Bücher und Schriften sind voller Propaganda von Staaten und Machthabern. Sie wurden von Unterdrückern geschrieben oder beauftragt, die sich selbst verherrlichten und auf den Rest herabsahen. Das Wor «Barbaren»wurde ursprünglich von den antiken Griechen erfunden, es bezeichnete lediglich alle, die kein Griechisch sprachen. Auf diese Weise wurde unser Bild von der Geschichte auf den Kopf gestellt. Zivilisation ist zum Synonym für Frieden und Fortschritt geworden, während die Wildnis für Krieg und Untergang steht. In Wirklichkeit war es für den größten Teil unserer Geschichte genau umgekehrt.
Thomas Hobbes, der alte Philosoph, hätte sich nicht gründlicher irren können. Er beschrieb das Leben unserer Vorfahren al «schmutzig, brutal und kurz», obwohl es eher zusammengehörig, friedlich und gesund war.
Bis zum Jahr 1800 waren weit über ein Viertel der Weltbevölkerung Leibeigene von Reichen.
Aus irgendeinem Grund konnten die Osterinsulaner nicht genug von diesen Steinskulpturen bekommen. Sie meißelten immer neue und rackerten sich dann ab, um sie an Ort und Stelle zu bekommen. Eifersüchtige Stammeshäuptlinge wünschten sich immer größere Moai ; immer mehr Nahrungsmittel mussten für die Erbauer bereitgestellt werden, und immer mehr Bäume mussten gefällt werden, um die Statuen zu transportieren. Aber: endloses Wachstum auf einer endlichen Insel? Das funktioniert nicht. Schließlich war kein Baum mehr übrig, sodass der Boden erodierte und auf den Äckern weniger zu ernten blieb. Ohne Holzkanus war Fischfang unmöglich. Die Produktion der Statuen geriet ins Stocken, und die Spannungen auf der Insel nahmen zu.
Die Osterinsel ist ein Tüpfelchen im Ozean; die Erde ist ein Pünktchen im Kosmos. Sie hatten keine Boote, um zu fliehen; wir keine Raumschiffe, um zu entkommen. Die Osterinsel wurde abgeholzt und übervölkert, unsere Welt wird verschmutzt und überhitzt.
Biologen vermuten, dass Millionen Ratten die Samen der Bäume aufgefressen haben, weshalb der Wald nicht mehr nachwachsen konnte.
Ich bin kein Skeptiker, was den Klimawandel angeht. Er ist die größte Herausforderung unserer Zeit, unserer Generation, und die Zeit drängt. Aber was mich sehr skeptisch macht, das sind die Untergangsszenarien. Ich bin skeptisch, wenn gesagt wird, dass wir zutiefst egoistisch oder, schlimmer noch, eine Plage seien. Ich bin skeptisch, wenn uns ein solches Menschenbild al «realistisch»verkauft werden soll. Und ich bin skeptisch, wenn unser Untergang als unvermeidlich hingestellt wird. Zu viele Umweltschützer unterschätzen die Wehrhaftigkeit des Menschen. Und ich fürchte, dass ihr Zynismus zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung werden kann, ein Nocebo, die entmutigt und die Erderwärmung dadurch nur beschleunigt. Auch die Klimabewegung braucht einen neuen Realismus.
Das größte Verbrechen in der Geschichte der Menschheit wurde nicht in einem primitiven Land begangen. Es geschah in einem der reichsten Länder der Erde, dem Land von Kant und Goethe, Bach und Beethoven. Vielleicht war die Zivilisation doch keine Schutzschicht. Vielleicht hatte Rousseau doch recht, und die Zivilisation wirkte wie ein Gift.
Stanford-Prison-Experiment
40 Jahre lang behauptete Philip Zimbardo in Hunderten von Interviews und Artikeln, dass die Bewacher keine Instruktionen erhalten hätten. Dass sie selbst an alles gedacht hätten: an die Regeln, die Strafen und die Demütigungen. Zimbardo tat so, als wäre Jaffe einfach nur einer der Wärter gewesen, der sich ebenfalls von dem Experiment hatte mitreißen lassen. Nichts könnte der Wahrheit weniger entsprechen. Es war in Wirklichkeit sogar Jaffe selbst, der ein umfangreiches Protokoll für die Aufnahme der Gefangenen erstellte. Die Ketten um die Knöchel? Seine Idee. Die Gefangenen ausziehen? Seine Idee. Sie fünfzehn Minuten lang nackt stehen lassen? Ebenfalls seine Idee. Tatsächlich hatte Jaffe bereits am Samstag vor dem Experiment sechs Stunden mit den Wärtern verbracht und ihnen erklärt, wie sie die Fesseln und Stöcke einsetzen sollten «Ich habe hier eine Liste davon, wie es ablaufen wird», sagte er, «eine Reihe von Dingen, die passieren müssen.»Am Ende des Experiments wurde Jaffe von seinen Kollegen für seine «sado – kreativen Ideen»gelobt.
Während de «Untersuchung»drängten er und Jaffe die Wärter immer wieder, so hart wie möglich aufzutreten. Wer nicht mitmachte, kriegte Ärger.
Das Faszinierende ist, dass die meisten Wärter im Stanford-Prison-Experiment sich weiterhin zurückhaltend verhielten, egal, wie viel Druck auf sie ausgeübt wurde. Zwei Drittel nahmen nicht an den sadistischen Spielen teil. Ein Drittel verhielt sich den Gefangenen gegenüber stets freundlich, zur großen Frustration von Zimbardo und seinen Kollegen.
In den letzten Jahrzehnten sind Millionen von Menschen auf das inszenierte Theaterstück von Philip Zimbardo hereingefallen. </span «Das Schlimmste ist», sagte einer der Gefangenen im Jahr 2011, «dass er 40 Jahre lang mit unglaublich viel Aufmerksamkeit belohnt wurde.»
Philip Zimbardo: Als ihn ein amerikanischer Journalist 2018 fragte, ob die Enthüllungen (über die weitreichenden Manipulationen) die Sicht der Menschen auf sein Experiment beeinflussen würden, antwortete der Psychologe schlicht, dass ihm das egal sei. «Die Leute können sagen, was sie wollen. Es ist die berühmteste Studie in der Geschichte der Psychologie. Es gibt keine Studie, über die die Leute noch nach 50 Jahren sprechen. Ganz normale Leute kennen sie. […] Sie hat inzwischen ein Eigenleben […]. Ich werde sie nicht mehr verteidigen. Ihre Lebensdauer selbst ist die Verteidigung.»
Stanley Milgram und die Schockmaschine
Es ist wieder mal die Geschichte eines Psychologen, der liebend gern berühmt werden wollte. Eines Psychologen, der manipulierte und täuschte, um die Ergebnisse zu erzielen, nach denen er suchte. Eines Psychologen, der sehenden Auges viel Leid über hilfsbereite Menschen brachte, die ihm vertrauten.
Der Mann im grauen Kittel, den Milgram angeheuert hatte, der Biologielehrer John Williams, versuchte es bei einigen Leuten acht – oder neunmal, damit sie weitermachten. Eine 46 – jährige Frau geriet in heftigen Streit mit ihm und stellte die Schockmaschine ab. Williams schaltete sie wieder an und verlangte, dass sie weitermachte. «Wenn man sich die Aufnahmen anhört», schreibt Gina Perry, «könnte man meinen, dass es bei der Untersuchung viel eher um Mobbing und Nötigung geht als um Gehorsam.»
Nur 56 Prozent glaubten, dass sie dem Schüler wirklich Schmerz zugefügt hatten. Tatsächlich zeigte eine niemals veröffentlichte Analyse von einem Assistenten Milgrams, dass die Mehrheit von ihnen das Experiment abbrach, als sie glaubten, dass die Schocks echt waren. Was also bleibt von einer solchen Studie, von der fast die Hälfte der Testpersonen annahm, sie sei gefälscht?
Der Weg zur Hölle ist mit guten Absichten gepflastert. Aber das Böse ist nicht an der Oberfläche, es muss mit großer Mühe nach oben gepumpt werden. Und noch wichtiger: Es muss sich immer als das Gute tarnen.
Eichmann kein gedankenloser Bürokrat war. Er war vielmehr ein Fanatiker. Er handelte nicht aus Gleichgültigkeit, sondern aus Überzeugung. Wie Milgrams Testpersonen tat er Böses, weil er es für das Gute hielt.
Die Befehle innerhalb der Bürokratie des Dritten Reiches waren aber im Gegenteil sehr vage, wissen Historiker. Es wurden überhaupt nur wenige formelle Befehle erteilt. Und deshalb mussten Hitlers Anhänger selbst kreativ werden. Der Historiker Ian Kershaw erklärt, dass sie Hitler nicht nur gehorchten, sondern «ihm zuarbeiteten». Sie versuchten, in seinem Geist zu handeln und sich dabei gegenseitig zu übertreffen. Immer radikaler werdende Nazis erfanden immer radikalere Maßnahmen, mit denen sie sich bei Hitler lieb Kind machen wollten. Der Holocaust wurde daher nicht von Menschen angerichtet, die sich plötzlich in Roboter verwandelt hatten, genauso wenig, wie die Teilnehmer an Milgrams Experiment gedankenlos den Knopf gedrückt hatten. Die Täter waren davon überzeugt, dass sie auf der richtigen Seite der Geschichte standen.
Viele Jahre lang hatten Schriftsteller und Dichter, Philosophen und Politiker die Psyche des deutschen Volkes abgestumpft und vergiftet. Der Homo puppy wurde belogen und indoktriniert, einer Gehirnwäsche unterzogen und manipuliert. Erst dann geschah das Undenkbare.
Philosophie von Hannah Arendt: der Mensch wird vom Bösen verführt, das im Gewande des Guten daherkommt
Kitty Genovese: Mord in Kew Gardens, 1964
Die Schlussfolgerung: Kitty starb nicht trotz, sondern wegen der Tatsache, dass die gesamte Nachbarschaft wach geworden war.
Das Schicksal von Kitty Genovese ist zu einer modernen Parabel geworden, zu einer Warnung vor der Anonymität der Stadt.
Jahrelang glaubte auch ich, dass der Zuschauereffekt zum Leben in einer geschäftigen Metropole einfach dazugehört.
Der Zuschauereffekt existiert wirklich. Manchmal nehmen wir an, dass wir in Notsituationen nichts tun müssen, weil auch andere die Verantwortung übernehmen könnten. Manchmal haben wir Angst, das Verkehrte zu tun, und wir tun lieber nichts aus Furcht vor dem Urteil anderer. Und manchmal meinen wir, dass überhaupt nichts los ist, weil wir sehen, dass auch andere nichts tun. Aber dann die zweite Schlussfolgerung. Liegt eine lebensbedrohliche Situation vor (jemand ertrinkt oder jemand wird angegriffen), und die Umstehenden können miteinander kommunizieren (und befinden sich daher nicht in einem abgeschlossenen Kabinett), ist die Rede von einem umgekehrten Zuschauereffekt. «Eine größere Anzahl von Zuschauern», schreiben die Forscher, «führt sogar zu mehr als zu weniger Hilfe.»
Warum, fragte sich Lindegaard als eine der ersten Wissenschaftlerinnen, machen wir so viel Aufhebens um Experimente, Umfragen und Interviews? Warum betrachten wir nicht einfach reale Bilder von realen Menschen in realen Situationen? Moderne Städte hängen voller Kameras.
In 90 Prozent aller Fälle helfen Menschen einander.
13. März 1964, aber jetzt auf Grundlage der sorgfältigen Recherchen
Diese berüchtigte Anzahl, die in Liedern und Theaterstücken, Blockbustern und Bestsellern auftaucht, geht aus einer Liste über Personen hervor, die von Polizisten verhört wurden. Doch die übergroße Mehrzahl der Leute auf dieser Liste waren überhaupt keine Augenzeugen. Die meisten von ihnen hatten allenfalls etwas gehört, und einige waren noch nicht einmal wach geworden.
Dutzende Bewohner von Kew Gardens beklagten sich, dass ihre Worte von der Presse beständig verdreht würden.
Kurz vor dem ersten Jahrestag des Mordes, am 11. März 1965, fand es eine Journalistin lustig, mitten in der Nacht herumzuschreien, dass sie angegriffen werde, während Fotografen bereitstanden, um die Reaktionen der Bewohner festzuhalten.
Es gab einen einzigen Radiojournalisten, Danny Meenan, der die Geschichte über die teilnahmslosen Zuschauer sofort angezweifelt hatte. Er überprüfte die Fakten und kam zu dem Schluss, dass die meisten Augenzeugen glaubten, dass sie eine betrunkene Frau gesehen hatten. Meenan fragte den Reporter der New York Times, warum er das nicht geschrieben habe. Die Antwort? Und warum hat Meenan das wiederum für sich behalten? Ganz einfach: In dieser Zeit legte man sich als Journalist nicht mit der mächtigsten Zeitung der Welt an. Nicht, wenn einem der Job lieb war.
Es ist erschreckend, zu sehen, wie wenig von der alten Geschichte übrig bleibt. Nicht die New Yorker Bürger, aber die Behörden haben in jener Nacht versagt. Kitty starb nicht mutterseelenallein, sondern in den Armen einer Freundin. Und mit dem Zuschauereffekt verhält es sich, wenn es darauf ankommt, genau andersherum. Wir sind in der Großstadt, in der überfüllten U-Bahn und auf vollen Plätzen nicht allein. Wir haben einander.
Tatsächlich wurde Kittys Mörder mit Hilfe von zwei Zuschauern gefasst – noch so eine Tatsache, über die keine Zeitung je auch nur ein Wort verlauten ließ.
Und das ist die wahre Geschichte von Kitty Genovese. Sie sollte nicht nur in die Lehrbücher von Psychologie – Erstsemestern Eingang finden, sondern auch in die für angehende Journalisten. Sie lehrt uns nämlich zwei Dinge. Erstens: wie oft unsere Sicht auf den Menschen verzerrt ist und wie sensationslüsterne Journalisten dieses Bedürfnis bedienen. Und zweitens: dass wir in Notfällen aufeinander zählen können.
Fassadentheorie & Soldaten
Varianten der Fassadentheorie wurden nach dem Zweiten Weltkrieg ohne Unterlass herausposaunt. Der Beweis schien erbracht. Milgram demonstrierte es mit seiner Schockmaschine. Die Medien verbreiteten es nach dem Tod von Kitty Genovese. Golding und Zimbardo wurden damit weltberühmt. In jedem Menschen lauert das Böse unter der Oberfläche, genau das, was Hobbes schon behauptet hatte. Doch nun, da sich die Archive zu den Experimenten und dem Mordfall geöffnet haben, ergibt sich ein völlig anderes Bild. Ein Bild, das auf dem Kopf steht. Die Wachen im Gefängnis von Zimbardo? Sie spielten nur Theater. Die Teilnehmer hinter der Milgram – Schockmaschine? Sie wollten Gutes tun. Und Kitty? Sie starb in den Armen ihrer Nachbarin. Die meisten Menschen waren bereit, einander zu helfen. Und wenn es eine Gruppe gab, die sich dem versagte, dann waren es die Machthaber. Die Wissenschaftler und die Chefredakteure, die Gouverneure und die Polizeikommissare. Es waren diese Leviathane, die logen und manipulierten. Sie haben ihre Probanden nicht vor ihrem sogenannten bösen Naturell geschützt, sondern sie gegeneinander ausgespielt.
Historiker fanden nach dem Krieg heraus, dass ein durchschnittlicher Wehrmachtssoldat 50 Prozent mehr Opfer tötete als ein alliierter Soldat. Eigentlich waren die deutschen Soldaten in fast allem besser. Ob sie angriffen oder sich verteidigten, ob sie Unterstützung aus der Luft bekamen oder nicht – es machte keinen Unterschied. «Es ist eine unbestreitbare Wahrheit», würde ein britischer Historiker später feststellen, «dass Hitlers Wehrmacht die beste Kampftruppe im Zweiten Weltkrieg war, eine der besten in der Geschichte.»
Nach dem D-Day erreichte die alliierte Propaganda nicht weniger als 90 Prozent der deutschen Soldaten in der Normandie.
Wochenlang befragte der junge Morris einen deutschen Kriegsgefangenen nach dem anderen. Er hörte immer wieder die gleichen Antworten. Nein, es lag nicht an der Anziehungskraft des Nazismus. Nein, sie glaubten nicht, dass sie gewinnen würden. Nein, sie waren keiner Gehirnwäsche unterzogen worden. Am Ende gäbe es einen viel einfacheren Grund, sagten sie, eine einfache Erklärung für die fast übermenschlichen Leistungen des deutschen Heeres. Kameradschaft. Freundschaft. Die Hunderte Bäcker und Metzger, Lehrer und Klempner, all jene deutschen Männer, die sich mit Händen und Füßen gegen den Vormarsch der Alliierten wehrten, standen dafür ein. Schlussendlich kämpften sie nicht für ein Tausendjähriges Reich oder für noch mehr Blut und Boden, wie Morris erkannte. Am Ende kämpften sie für ihre Kameraden, die sie nicht im Stich lassen wollten. «Der Nationalsozialismus beginnt zehn Meilen hinter der Front», höhnte einer der Kriegsgefangenen. Die Kameradschaft hingegen wäre in jedem Bunker und Graben zu finden.
Taktik, Ausbildung und Ideologie – das alles ist wichtig für eine Armee, schlossen Morris und seine Kollegen daraus. Aber am Ende wird die Stärke einer Armee vor allem durch die kameradschaftlichen Beziehungen der Soldaten untereinander bestimmt. Kameradschaft ist die Waffe, mit der man Kriege gewinnt.
Die Deutschen verfügten, wie sich herausstellte, über eine Art «Kriegsethos». Loyalität, Kameradschaft und Opfergeist waren ihnen am wichtigsten, während Judenhass und ideologische Reinheit nur eine geringe Rolle spielten.
Viele alliierte Soldaten weigerten sich, befördert zu werden, wenn das zur Folge hatte, in eine andere Einheit versetzt zu werden. Viele Verwundete und Kranke lehnten Urlaub ab, um nicht durch einen neuen Rekruten ersetzt zu werden. Einer flüchtete sogar aus dem Krankenhaus, um an die Front zurückzukehren «Wieder und wieder», bemerkte ein Soziologe überrascht, «stießen wir auf [Soldaten], die das eigene Interesse hintanstellten, weil sie fürchteten, die anderen Jungs im Stich zu lassen.»
Das Böse resultierte seiner Meinung nach nicht aus dem Sadismus verkommener Bösewichte, sondern aus der Verbundenheit tapferer Kämpfer. Der Zweite Weltkrieg war ein Kampf von Millionen gewöhnlicher Menschen, angetrieben vom Besten der menschlichen Natur – Freundschaft, Loyalität, Treue –, um so das größte Gemetzel in der Geschichte anzurichten.
Wenn es eine Eigenschaft gibt, der Wissenschaftler bei Terroristen immer wieder begegnen: dass sie empfänglich sind. Empfänglich für die Meinungen anderer. Anfällig für Autoritäten. Sie gieren nach Anerkennung und wollen ihrer Familie und ihren Freunden Gutes tun. «Attentäter töten nicht für eine Ideologie», merkt ein amerikanischer Anthropologe an. «Sie morden füreinander.»
Politiker sprechen oft von einem «feigen Akt», aber in Wirklichkeit braucht es großen Mut und Durchsetzungsvermögen, um sich selbst im Kampf zu eliminieren.
Der Homo puppy ist kein unbeschriebenes Blatt. Bereits in der Wiege geben wir dem Guten den Vorzug, es liegt in unserer Natur.
Babys haben bereits, bevor sie sprechen können, eine Abneigung gegen das Unbekannte. In Dutzenden von Experimenten haben die Forscher des Baby Lab nachgewiesen, dass Babys keine fremden Gesichter, seltsamen Gerüche, Fremdsprachen und seltsamen Akzente mögen. Es scheint, dass wir als Xenophoben geboren werden.
Kleinkinder seien kleine Egoisten, lautete der Konsens zu Beginn des 21. Jahrhunderts.
Reihe von Experimenten
Kinder im Alter von nur anderthalb Jahren wollen nichts lieber, als anderen zu helfen.
Empathie empfinden wir vor allem für Menschen, die uns nahestehen. Menschen, die wir riechen, sehen, hören und fühlen können.
Als ich das Buch von Bloom las, dämmerte mir, was der Empathie ähnelt. Die Nachrichten. Bereits im 1. Kapitel habe ich gezeigt, dass die Nachrichten ebenfalls wie ein Scheinwerfer funktionieren. Und wie Empathie täuschen. Indem sie auf den Einzelnen heranzoomen, täuschen die Nachrichten, indem sie sich vor allem auf die Ausnahme fokussieren (Unfall! Anschlag! Krieg!).
Eines ist sicher: Wer sich nach einer besseren Welt sehnt, kommt mit ein bisschen Empathie nicht weit. Schlimmer noch: Empathie kann der Vergebung im Wege stehen, denn Menschen, die sich stärker in die Opfer einfühlen, verallgemeinern auch ihre Feinde stärker. Der Mechanismus ist immer derselbe: Wir setzen unsere Lieben ins rechte Licht und werden blind für die Perspektive unserer Gegner, die außerhalb unseres Blickfeldes stehen.
Es ist eine unbequeme Wahrheit: Empathie und Fremdenfeindlichkeit sind zwei Seiten derselben Medaille.
Im Laufe der Geschichte hat das Kriegsmaterial zu einer immer besseren Lösung des Hauptproblems eines jeden Krieges beigetragen: der urmenschlichen Abneigung gegen Gewalt. Es ist fast unmöglich, jemandem in die Augen zu schauen und ihn zu erschießen. So, wie die meisten von uns Vegetarier werden wollen, wenn wir selbst einmal eine Kuh schlachten mussten, so kommen fast alle Soldaten in Gewissensnöte, sobald ihnen der Feind zu nahe kommt. Kriege werden denn traditionell auch dadurch gewonnen, dass so viele Menschen wie möglich aus gehörigem Abstand schießen.
Paris wäre wahrscheinlich nicht gefallen, wenn die Deutschen 1940 nicht 35 Millionen Methamphetamin – Tabletten genommen hätten (auch bekannt als Crystal Meth, eine Droge, die extrem aggressiv machen kann).
Wenn der Homo puppy von Natur aus ein so freundliches Wesen ist, wie ist es dann möglich, dass Egoisten und Raffkes, Narzissten und Soziopathen so oft ganz nach oben gelangen? Wie ist es möglich, dass sich Menschenwesen, die vor Scham erröten – als einzige Spezies im Tierreich –, von Gestalten leiten lassen, die völlig schamlos sind?
Machiavelli – Il Principe (Der Fürst)
Stimmt die philosophische Theorie Machiavellis? Müssen Menschen schamlos lügen und betrügen, um an die Macht zu gelangen und sie zu behalten? Was sagt die moderne Wissenschaft dazu?
Fast jeder glaubt, dass Machiavelli recht hat. Zweitens: Es gibt kaum wissenschaftliche Untersuchungen zu seiner Theorie.
Es ist wie in prähistorischen Zeiten: In Mini – Gesellschaften ist Arroganz von Übel. Die Leute halten den Betreffenden für einen Idioten und schließen ihn aus. Laut Keltner sind es die freundlichsten und empathischen Menschen, die sich als Anführer herausbilden. Survival of the friendliest.
Keltner hat auch die Wirkung von Macht erforscht, wenn man sie einmal errungen hat. Und da kam er zu ganz anderen Schlussfolgerungen. Die vielleicht phantasievollste Studie ist nach dem Krümelmonster aus der Sesamstraße benannt.
Die ersten Probanden fuhren in einem klapprigen Mitsubishi oder Ford Pinto auf einen Zebrastreifen zu, den nur ein Fußgänger überqueren wollte. Sie alle hielten brav an. Je teurer das Auto, desto ungehobelter das Fahrverhalten.
Mächtige Menschen haben die gleichen Neigungen. Sie verhalten sich so, als hätten sie einen Hirnschaden erlitten. Im wörtlichen Sinne. Sie sind impulsiver, egoistischer, rücksichtsloser, arroganter, narzisstischer und grobschlächtiger als der Durchschnitt. Sie gehen öfter fremd, hören weniger gut zu und nehmen seltener die Perspektive eines anderen ein. Sie sind schamloser und zeigen selten den ganz spezifischen Gesichtsausdruck, der die Menschen im Tierreich einzigartig macht. Sie erröten nicht. Macht scheint wie eine Art Anästhetikum zu wirken, das den Betreffenden von anderen abgrenzt.
Sie entdeckten, dass Machtgefühle einen mentalen Prozess stören, den Wissenschaftler auch al «Spiegelung»bezeichnen, einen Prozess, der eine wichtige Rolle bei der Empathie spielt.
Normalerweise ist der Mensch ein sich durch und durch spiegelndes Wesen. Wenn jemand lacht, lachen wir ebenfalls. Wenn jemand gähnt, gähnen wir mit. Aber die Mächtigen spiegeln seltener. Es ist, als wären sie nicht mehr mit anderen Menschen verbunden. Als wäre der Stecker gezogen.
Eine Reihe Untersuchungen hat gezeigt, dass Macht zu einer negativen Einstellung anderen Menschen gegenüber führt.
Die Machthaber gehen nicht selten davon aus, dass die meisten Leute faul und unzuverlässig sind. Aus dieser negativen Sicht auf die Menschheit schließen sie, dass wir geleitet und ausspioniert, gemanagt und reguliert, zensiert und kommandiert werden müssen. Und dass sie selbst die dafür auserwählte Person sind, genau das zu tun. Macht verleiht das Gefühl, anderen überlegen zu sein. Das Traurige ist, dass Machtlosigkeit genau den entgegengesetzten Effekt hat. Psychologische Untersuchungen zeigen, dass Menschen, die sich machtlos fühlen, viel unsicherer sind. Sie zögern, ehe sie ihre Meinung äußern. Sie machen sich in einer Gruppe klein. Sie kommen sich dümmer vor, als sie wirklich sind.
Diese Art von unsicheren Gefühlen spielt den Machthabern in die Hände. Menschen, die an sich zweifeln, rebellieren nicht. Unsichere Menschen müssen nicht einmal zensiert werden, weil sie sich selbst den Mund verbieten.
Hier sehen wir ein Nocebo in Aktion: Wenn man andere behandelt, als wären sie dumm, werden sie sich auch dumm vorkommen, worauf die Machthaber sich dann getrost selbst einreden können, dass das Volk nun einmal zu dumm sei, um mit zu entscheiden, und dass sie selbst die Führung übernehmen müssen (mit ihrer gewaltigen Vision und ihrem Weitblick).
Bereits Ende des 19. Jahrhunderts schrieb der britische Historiker Lord Acton die berühmten Worte «Macht korrumpiert, und absolute Macht korrumpiert absolut.»
Studien weisen eine nach der anderen nach, dass Menschen die bescheidensten und freundlichsten Typen zum Anführer wählen. Aber sobald diese Führer an der Spitze stehen, kann es passieren, dass ihnen die Macht zu Kopfe steigt. Und dann versuchen Sie mal, die wieder loszuwerden.
Doch zeigen immer weitere Forschungsergebnisse, dass mehr von diesen freundlichen Affen in uns steckt als von den machiavellistischen Schimpansen.
Ein amerikanischer Anthropologe verglich 48 Studien über Jäger und Sammler und kam zu dem Schluss, dass Machiavellismus fast immer ein Rezept für Misserfolge gewesen sei.
Eine Führungsposition war unter Jägern und Sammlern außerdem zeitlich beschränkt, und die Entscheidungen wurden gemeinsam getroffen. Jeder, der sich so verhielt, wie Machiavelli es später vorschreiben würde, hätte sich unweigerlich in Lebensgefahr gebracht. Egoisten wurden ausgeschlossen und liefen Gefahr zu verhungern. Niemand wollte Nahrung mit Menschen teilen, die nur an sich selbst dachten.
Ein bisschen Ungleichheit finden wir prima, betonen Psychologen, solange sie sich auf etwas gründet. Solange es fair zu sein scheint. Wenn man die Massen davon überzeugen kann, dass man klüger, besser oder frommer ist, werden andere es logisch finden, dass man die Führung übernimmt.
Mit Hilfe von Mythen brachten die Menschheit und ihre Machthaber etwas zuwege, was keiner anderen Spezies je gelang. Mythen halfen uns dabei, im großen Maßstab mit Fremden zusammenzuarbeiten.
Die Gründerväter der Vereinigten Staaten wollten nicht, dass sich der Bürger allzu viel mit Politik abgibt. Heute darf sich zwar jeder zur Wahl stellen, aber in der Praxis ist es schwierig, Wahlen zu gewinnen, wenn man keinen Zugang zu einem aristokratischen Netzwerk von Spendern und Lobbyisten hat. Es ist deshalb kein Zufall, dass die amerikanisch «Demokratie» dynastische Züge aufweist – denken Sie an die Kennedys, die Bushs und die Clintons.
In einer hierarchisch gestalteten Gesellschaft haben die Machiavellisten einen Vorteil. Sie besitzen einen ultimativen Trumpf, eine Eigenschaft, mit der sie ihre Konkurrenz immer wieder ausstechen. Sie sind schamlos.
Leider gibt es immer auch Leute, denen jegliches Schamgefühl abgeht. Ich spreche von Menschen, die unter der Droge Macht stehen, oder von einer kleinen Minderheit, die mit soziopathischen Zügen geboren wurde. Bei Jägern und Sammlern hielten sich solche Typen nicht lange. Sie wurden von der Gruppe verstoßen. Aber in großen, modernen Unternehmen scheinen Soziopathen die Karriereleiter schneller heraufzuklettern. Einige Studien zeigen, dass bei vier bis acht Prozent der CEOs Soziopathie diagnostiziert werden kann, im Vergleich zu dem einen Prozent in der sonstigen Bevölkerung. In eine «Demokratie» kann Schamlosigkeit eine große Hilfe sein. Politiker, die kein Schamgefühl besitzen, können Dinge tun, die für andere schlichtweg unmöglich sind. Wofür sich dann andere wieder in Grund und Boden schämen würden.
Die britischen Experten hatten eine Massenpanik vorhergesagt. Plünderungen und Aufruhr. Krisensituationen würden uns auf unsere brutale Natur zurückwerfen, und ein Krieg jeder gegen jeden würde ausbrechen. Aber das Gegenteil war der Fall. Katastrophen fördern das Beste in uns zutage. Es ist, als würde auf einen Reset – Knopf gedrückt, und wir kehrten zu unserem besseren Ich zurück.
Auch das ist eine Lehre des Luftkrieges: Die schlimmste Gewalt kommt nicht aus nächster Nähe, sondern aus weiter Ferne. Als die Briten Pläne für ihre eigenen Bombenwerfer ausarbeiteten, stellte sich schließlich heraus, in welchem Maße Macht korrumpieren kann. Frederick Lindemann, Churchills bester Freund, ignorierte die Beweise, dass man ein Volk nicht mit Bomben niederzwingen kann. Für ihn stand fest, dass die Deutschen in die Knie gehen würden. Wer ihm widersprach, wurde als Landesverräter weggesperrt «Die Tatsache, dass die Bombardements mit so wenig Gegenwehr durchgedrückt wurden», bemerkte ein Historiker später« ist ein typisches Beispiel für die Hypnose der Macht.»
Der Homo puppy ist ein durch und durch paradoxes Wesen. Zuerst einmal sind wir eine der freundlichsten Arten im Tierreich. Den größten Teil unserer Geschichte haben wir in einer egalitären Welt verlebt.
Die Menschen ließen sich an einem Ort nieder und erfanden den Privatbesitz. Von diesem Moment an verlor unser Gruppeninstinkt seine Unschuld. In Kombination mit Mangel und Hierarchie erwies sich das als pures Gift. Auch die korrumpierenden Auswirkungen der Macht, die wir so lange niedergehalten hatten, waren nicht mehr einzudämmen, als den Anführern Heere zur Verfügung standen. In der neuen Welt der Bauern und Krieger, Städte und Staaten zeigte sich, dass Freundlichkeit und Fremdenfeindlichkeit beunruhigend nahe beieinanderliegen. Menschen wollen Teil von etwas sein, und sie grenzen sich gegen Außenstehende ab. Wir finden es schwierig, nein zu den Anführern unserer eigenen Gruppe zu sagen, auch wenn sie uns auf die falsche Seite der Geschichte führen.
Der moderne Kapitalismus, die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit gründeten sich auf die Idee, dass wir alle Egoisten sind.
David Hume.
Es ist daher ein berechtigter Grundsatz in der Politik, dass jeder Mensch als Schurke betrachtet werden sollte, obwohl es gleichzeitig etwas seltsam anmutet, dass ein Grundsatz wahr sein sollte, der ansonsten den Tatsachen nicht entspricht.
Bertrand Russell
Wenn Sie etwas studieren oder versuchen, eine Philosophie zu bewerten, fragen Sie sich einfach nur, um welche Fakten es geht und welche Wahrheit von diesen Fakten gestützt wird. Lassen Sie sich niemals von dem beeinflussen, was Sie glauben möchten, oder von etwas, von dem Sie annehmen, dass es nützliche soziale Auswirkungen hätte, wenn es geglaubt würde. Betrachten Sie lediglich die Fakten.
Zu Beginn des neuen Schuljahres wird den Lehrern der Spruce School mitgeteilt, dass ein renommierter Wissenschaftler, ein gewisser Bob Rosenthal, einen fortgeschrittene «Hidden Acquisition Test» entwickelt hat. Damit könne er vorhersagen, welche Schüler im kommenden Schuljahr die größten Sprünge nach vorn machen würden. Die Lehrer wissen nicht, dass es sich um einen gewöhnlichen IQ-Test handelt. Mehr noch, Rosenthal und sein Team legen die Punktskala beiseite und werfen einfach eine Münze, um festzulegen, welche Schüler das größt «Potenzial»haben sollen. Sie lassen diese Erwartung gegenüber den Lehrern durchsickern, während die Kinder ihre Punktzahl nicht erfahren. Und ja: Auch hier wirkt die magische Kraft der Erwartung. Die Lehrer widmen de «klugen»Gruppe mehr Aufmerksamkeit, Komplimente und hoffnungsvolle Blicke, wodurch auch die Kinder beginnen, sich selbst mit anderen Augen zu sehen. Der Effekt auf junge Schüler fällt am deutlichsten aus: Sie vollziehen innerhalb eines Jahres einen durchschnittlichen Sprung von 27 IQ – Punkten. Die größten Fortschritte werden von Jungen mit mexikanischem Aussehen erzielt, eine Gruppe, von der normalerweise am wenigsten erwartet wird. Rosenthal nennt seine Entdeckung de «Pygmalion – Effekt»nach dem mythologischen Künstler, der sich so sehr in die Frauenstatue verliebte, die er selbst angefertigt hatte, dass die Götter beschlossen, sie zum Leben zu erwecken. Der Pygmalion-Effekt erinnert an den Placebo-Effekt
Nun reden wir aber nicht von einer Erwartung, die uns selbst nützt. Es ist eine Erwartung, die anderen weiterhilft.
Immer wieder zeigt sich: Erwartungen sind mächtige Waffen. Wenn Manager mehr erwarten, schaffen Mitarbeiter mehr. Wenn Offiziere mehr erwarten, kämpfen Soldaten härter. Wenn Pflegekräfte mehr erwarten, geht es Patienten schneller besser.
Menschen, von denen weniger erwartet wird, leisten weniger und schneiden dann auch noch schlechter ab. Es gibt sogar Hinweise darauf, dass der Golem-Effekt ganze Organisationen in den Abgrund ziehen kann, wenn sich
Menschen sind durch und durch sich gegenseitig spiegelnde Wesen.
Wenn Menschen schlechte Ideen voneinander übernehmen – Ideen, von denen man denkt, dass jeder an sie glaubt –, können daraus die größten Katastrophen resultieren.
Jeder Einzelne unter den Studenten fand Arielys Geschichte unverständlich. Aber jeder sah auch seine Kommilitonen aufmerksam zuhören, also glaubten alle, dass es nur an ihnen liegen könne
Aber pluralistische Unwissenheit kann laut Forschung lebensbedrohliche Formen annehmen. Ein gutes Beispiel ist das Komasaufen. Wenn Schüler einzeln befragt werden, machen sie sich in der Regel nichts daraus. Aber weil sie glauben, dass andere Studenten es cool finden, landen sie trotzdem kotzend in der Gosse. Wir verfügen inzwischen über eine ganze Reihe von Untersuchungen, die zeigen, dass eine solche negative Spirale auch bei viel größeren Übeln wie Rassismus, Gruppenvergewaltigungen, Ehrenmorden, Unterstützung von Terroristen und diktatorischen Regimen und sogar Völkermord auftreten kann.
Innerlich missbilligen die Täter ihr Handeln, aber sie befürchten, dass sie damit alleine stehen. Und machen also doch mit. Der Homo puppy hat es schwer, gegen die Gruppe aufzutreten. Wir sind in der Lage, das größte Elend über ein bisschen Scham oder Unbehagen zu stellen. Deshalb habe ich mich gefragt: Könnte unser negatives Menschenbild auch eine Form der pluralistischen Unwissenheit sein? Unterstellen wir, dass die meisten Menschen egoistisch sind, weil wir davon ausgehen, dass die anderen das Gleiche denken? Und fügen wir uns deshalb diesem Zynismus, während wir uns eigentlich nach einem Leben mit mehr Freundlichkeit und Zusammengehörigkeit sehnen?
Ab und zu scheinen Familien, Unternehmen oder ganze Länder in der gleichen Spirale zu stecken. Wir drehen uns weiter im Kreise, wir schlagen den falschen Weg ein, nur wenige von uns widersetzen sich – und so marschieren wir unserem Untergang entgegen.
Denn nicht allein Hass, auch Vertrauen ist ansteckend. Solches Vertrauen beginnt oft bei jemandem, der es wagt, gegen den Strom zu schwimmen. Jemand, der zunächst noch unrealistisch oder vielleicht sogar naiv erscheint.
Zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Die Disziplin Betriebswissenschaft kam damals auf, und dieses neue Forschungsfeld basierte auf einem Hobbes’schen Menschenbild. Wir wären von Natur aus habgierige Kreaturen.
Banker bekommen Boni, weil sie härter arbeiten, Arbeitslosengeld wird gekürzt, damit die Leute vom Sofa hochkommen, Kinder erhalten ein «Ungenügend», damit sie sich mehr anstrengen. Das Faszinierende ist, dass die beiden großen Ideologien des 20. Jahrhunderts, Kapitalismus und Kommunismus, das gleiche Menschenbild zugrunde legen. Der Kapitalist und der Kommunist stimmten darin überein, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt, Menschen in Bewegung zu setzen. Zuckerbrot und Peitsche.
Der Kapitalismus basiert auf genau diesem zynischen Menschenbild «Was die Arbeitnehmer von ihren Arbeitgebern am liebsten wollen, sind vor allem hohe Löhne», sagte vor 100 Jahren einer der ersten Unternehmensberater, Frederick Taylor.
1969, Edward Deci, ein junger Psychologe, hatte das Gefühl, dass an dieser Theorie (Behaviorismus) etwas nicht stimmte. Die Menschen tun ständig seltsame Dinge, die nicht ins behavioristische Menschenbild passen. Man denke ans Bergsteigen (anstrengend!), Freiwilligenarbeit (unbezahlt!) und Kinderkriegen (heftig!). Wir tun die ganze Zeit Dinge, die kein Geld einbringen und sogar sterbenslangweilig sind, ohne dazu gezwungen zu werden.
Sie fanden «überwältigende Beweise», dass Boni die innere Motivation und den moralischen Kompass der Mitarbeiter abstumpfen können.
Sie entdeckten zudem, dass Boni und Ziele auch die Kreativität beeinträchtigen können.
Wer stundenweise bezahlt, bekommt mehr Stunden. Wer pro Publikation bezahlt, bekommt mehr Publikationen. Wer pro Operation bezahlt, bekommt mehr Operationen. Chirurgen, die pro Behandlung bezahlt werden, neigen dazu, schneller zum Skalpell zu greifen, anstatt eine bessere Versorgung anzubieten.
Eine kürzlich durchgeführte britische Studie ergab, dass sich die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung (74 Prozent) eher mit Werten wie Hilfsbereitschaft, Ehrlichkeit und Gerechtigkeit als mit Geld, Status und Macht identifiziert. Aber die Forscher fanden auch heraus, dass der größte Anteil – 78 Prozent – der Meinung ist, dass andere egoistischer sind, als es in Wirklichkeit der Fall ist.
Nocebo-Effekt vergessen: Was man annimmt, ist das, was man heraufbeschwört.
Schließlich ist es erstaunlich zu sehen, wie oft wir wegen Zielen, Boni und Androhungen von Strafen in Schwierigkeiten geraten: Man denke an CEOs, die sich einzig auf ihre Quartalsergebnisse fokussieren und damit ihr Unternehmen in den Abgrund reißen. Man denke an Wissenschaftler, die nach der Menge ihrer Publikationen bezahlt werden und deshalb in Versuchung geraten zu betrügen. Man denke an Schulen, die an den messbaren Ergebnissen von standardisierten Tests gemessen werden und deshalb im Unterricht weniger auf das achten, was nicht messbar ist. Man denke an Psychologen, die dafür bezahlt werden, so lange wie möglich zu behandeln, und also auch so lange wie möglich weitermachen. Man denke an Bankiers, die ihre Boni durch den Verkauf von Schrotthypotheken verdienen und dann das globale Finanzsystem ins Wanken bringen.
Fachkräfte stecken voller Ideen. Sie denken an tausend Dinge, nur hört man ihnen nicht zu. Denn die Manager glauben, dass sie, wenn sie sich irgendetwas aus den Fingern gesaugt haben, sie die Fachkräfte unbedingt daran teilhaben lassen müssen.»
Buurtzorg
De Blok hat eine ganz andere Vision. Er sieht seine Mitarbeiter als innerlich motivierte Profis, die selbst am besten wissen, wie sie ihre Arbeit zu machen haben «Meine Erfahrung ist, dass viele Manager entsetzlich wenige Ideen entwickeln. Sie haben ihren Job bekommen, weil sie ins System passen. Und weil sie folgsam sind. Aber nicht, weil sie große Visionäre sind.
Wir haben Krankenhäuser mit kaufmännischen Abteilungen und Verkaufsteams! Auf der anderen Seite stehen die Versicherer mit ihren Einkaufsteams. Auf beiden Seiten sitzen Leute ohne jeglichen Hintergrund im Pflegewesen. Der eine kauft ein, der andere verkauft – und beide wissen nicht, worum es hier eigentlich geht. »In der Zwischenzeit schwillt die Bürokratie an, denn wenn man aus der Pflege einen Markt machen will, hat man viel Papierkram zu erledigen
Wenn man Mitarbeiter behandelt, als wären sie verantwortungsbewusst und zuverlässig, dann sind sie es auch.
Unternehmen wie Buurtzorg und FAVI zeigen, dass sich alles ändert, wenn man nicht vom Misstrauen ausgeht, sondern von einem positiven Menschenbild. Expertise und Kompetenz entwickeln sich zu den wichtigsten Werten, nicht Rendite und Produktivität.
Wie schaffen wir eine Gesellschaft, in der sich Menschen selbst motivieren? Diese Frage ist weder links noch rechts, noch ist sie kapitalistisch oder kommunistisch. Wir sprechen von einer neuen Bewegung. Über einen neuen Realismus. Denn nichts ist mächtiger als Menschen, die etwas tun, weil sie es tun wollen.
Kinder & «Spielen»
In den zurückliegenden Jahrzehnten ist die innere Motivation von Kindern schwer in Bedrängnis geraten. Kinder werden immer öfter von Erwachsenen beschäftigt.
die Freiheit, der eigenen Neugier zu folgen, zu suchen und zu entdecken, auszuprobieren und Neues zu schöpfen. Nicht, weil Eltern oder Lehrer es einem vorkauen, sondern einfach, weil man Lust dazu hat. Fast überall, wohin man schaut, ist die Freiheit von Kindern eingeschränkt.
Im Jahr 1971 gingen in Großbritannien noch 80 Prozent der Sieben – und Achtjährigen allein zur Schule. Jetzt sind es zehn Prozent. Eine Umfrage unter 12.000 Eltern aus zehn Ländern hat jüngst ergeben, dass die meisten Kinder seltener an die frische Luft kommen als Häftlinge im Strafvollzug.
Im Englischen wird zwischen game und play unterschieden. Das Erstere ist in ein Regelwerk eingefasst, das Zweite ist offen und frei.
Durch das gemeinsame Spiel lernen Kinder außerdem, wie man zusammenarbeitet.
Es ist daher wenig überraschend, dass in diesen Kulturen kaum Spiele gespielt werden, in denen es darum geht, miteinander in Wettbewerb zu treten.
Kinder, deren Verhalten als zu verspielt galt, wurden in manchen Fällen sogar zum Arzt geschickt. So ist in den vergangenen Jahrzehnten die Zahl der Diagnosen, die au «Verhaltensstörung» lauteten, enorm gestiegen. ADHS ist vielleicht das beste Beispiel – ich hörte einmal einen Psychiater seufzen, dass sie die einzige saisongebundene Störung sei, die er kenne: In den Sommerferien scheine sie keine Probleme zu bereiten, doch wenn die Schule wieder anfange, müssten eine ganze Menge kleiner Jungen wieder Ritalin schlucken.
Schwierige Kinder werden nicht mehr geschlagen, sondern mit Drogen ruhiggestellt.
Inzwischen gibt es Berge an wissenschaftlichen Beweisen dafür, dass freies, risikoreiches Spielen gut für die körperliche und mentale Gesundheit von Kindern ist.
Häufig wird das Mobbing als ein Naturphänomen gesehen, etwas, das nun einmal zum kindlichen Verhalten gehört. Soziologen haben jedoch inzwischen umfangreiche Untersuchungen zu den Orten durchgeführt, an denen am meisten gemobbt wird. Und diese Orte scheinen spezielle Merkmale zu haben. Sie werden auch «totale Institutionen» genannt.
Es ist eine verkehrte Welt. Wir verwenden Milliarden darauf, unseren größten Talenten die Karriereleiter hinaufzuhelfen, die sich dann – einmal oben angekommen – fragen, wofür sie das alles eigentlich machen. Gleichzeitig hören Politiker nicht auf zu fordern, dass wir in den Ranglisten noch besser abschneiden müssen. Dass wir noch «höher qualifiziert» werden, noch mehr Geld verdienen und die Wirtschaft noch weite «wachsen» lassen müssen. Doch wofür stehen all die Zeugnisse? Sind sie der Beweis für Kreativität und Phantasie oder für die Fähigkeit, stillzusitzen und ja zu sagen?
De Art und Weise, in der viele von uns heute arbeiten – ohne Freiheit, ohne Spiel, ohne innere Motivation –, macht immer mehr Menschen depressiv. Laut der Weltgesundheitsorganisation ist die Depression inzwischen die Volkskrankheit Nummer eins.
Kinder lernen am besten in Freiheit, in einer Gemeinschaft, die alle Altersgruppen und schulische Niveaus inkludiert, mit Coaches und Spielleitern, die nicht einschränken, sondern bei der Entwicklung helfen.
Bürgerhaushalt: Torres, 205.000 Einwohnern
Weltweit werden unsere Demokratien von mindestens sieben Plagen heimgesucht. Parteien, die zerbröckeln. Bürger, die einander nicht vertrauen. Minderheiten, die ausgegrenzt werden. Wähler, die ihr Interesse verlieren. Politiker, die sich als korrupt erweisen. Reiche, die ihre Steuern hinterziehen. Und hinzu kommt das nagende Bewusstsein, dass die heutige Demokratie mit einer tiefverwurzelten Ungleichheit einhergeht.
Julio Chávez, war eine Randfigur. Julio wollte, sollte er zum Bürgermeister gewählt werden, seine Macht an die Einwohner von Torres weitergeben.
Kaum zehn Jahre nach der Wahl von Julio Chávez schien es, als wären in Torres Jahrhunderte vergangen. Die Korruption und die Klientelpolitik waren, wie sich aus einer Untersuchung der Universität von Kalifornien ergab, stark zurückgegangen, und die Bürger engagierten sich politisch so stark wie nie zuvor. Zahllose Häuser und Schulen waren aus dem Boden gestampft, Straßen angelegt und Wohnquartiere erneuert worden. Bis auf den heutigen Tag hat Torres einen der größten Bürgerhaushalte der Welt. Gut und gern 15.000 Menschen beteiligen sich jährlich daran.
Gemeinsam wird beschlossen, wie die Millionen an Steuergeldern verwandt werden sollen «Früher blieben die Beamten den ganzen Tag über in ihren Büros mit Klimaanlagen, wo sie ihre Entscheidungen trafen», erzählte einer der Einwohner «Aber wer, glaubst du, kann besser darüber entscheiden, was wir brauchen? Ein Beamter in seinem Büro, der noch nie in unsere Gemeinde gekommen ist, oder einer aus der Gemeinschaft selbst?»
Anno 2016 hatten mehr als 1.500 Städte, von New York bis Sevilla und von Hamburg bis Mexiko – Stadt, eine «partizipativen Haushalt» eingeführt.
Tatsächlich sprechen wir hier über eine der größten Bewegungen des 21. Jahrhunderts – und dennoch ist die Chance groß, dass Sie noch nie davon gehört haben. Nur wenige Nachrichtensendungen sind daran interessiert.
- Von Zynismus zu Engagement
- Von Zersplitterung zu Vertrauen
- Von Ausgrenzung zu Inklusivität
- Von Bequemlichkeit zu bürgerschaftlichem Denken und Handeln
- Von Korruption zu Transparenz
- Von Egoismus zu Solidarität – Es klingt unglaublich, aber wie Wissenschaftler herausgefunden haben, sorgt der partizipative Haushalt dafür, dass Bürger bereit sind, mehr Steuern zu zahlen. Die Menschen beschließen schließlich selbst, was mit dem Geld passiert.
- Von Ungleichheit zu sozialem Aufschwung
Dank des Bürgerhaushalts wurde außerdem, wie eine Evaluation der Weltbank ergab, sehr viel weniger Geld für prestigeträchtige Immobilienprojekte und mehr für Infrastruktur, Bildung und Gesundheit ausgegeben.
Garrett Hardin – «the commons»
Es dauerte nicht lange, bis die Politologin entdeckte, dass Hardin in seinem Essay ein entscheidendes Detail übersehen hatte. Menschen können innerhalb einer Gemeinschaft kommunizieren. Bauern, Fischer und Bürger sind bestens in der Lage, Verabredungen darüber zu treffen, dass ihre Äcker nicht veröden, ihre Seen nicht leer gefischt werden und ihre Brunnen nicht austrocknen.
Ein ums andere Mal entdeckte sie, dass von einer «Tragödie» keine Rede sein konnte, wie Hardin behauptet hatte. Natürlich können Commons durchaus an Egoismus und gegensätzlichen Interessen zugrunde gehen. Aber das muss nicht zwangsläufig so sein. Insgesamt sammelten Ostrom und ihre Kollegen mehr als 5000 Beispiele funktionierender Commons.
In ihrem bahnbrechenden Werk Governing the Commons (1990 ; deutsche Ausgabe: Die Verfassung der Allmende: Jenseits von Staat und Markt) formulierte Ostrom eine Reihe von «Entwurfsprinzipien», die erfolgreiche Commons auszeichnen. Eine Gemeinschaft müsse beispielsweise selbständig genug sein, und es bedürfe einer effektiven sozialen Kontrolle. Aber Ostrom betonte, dass es keine Blaupause gebe, letztlich gehe es um den lokalen Kontext.
Und über Jahrhunderte hinweg funktionierten diese Commons ausgezeichnet. Erst im 18. Jahrhundert gerieten sie erneut unter Druck. Die aufgeklärten Ökonomen der damaligen Zeit fanden, dass die gemeinschaftlich bewirtschafteten landwirtschaftlichen Flächen nicht produktiv genug seien. Also empfahlen sie dem Staat die sogenannten enclosures: Der gemeinschaftliche Besitz wurde zerstückelt und unter reichen Grundeigentümern verteilt. Unter ihrer Obhut sollte die Produktivität steigen.
Der Mensch ist von Natur aus ein solidarisches Wesen.
Norwegische Gefängnisse
In einem Wald in Norwegen, ungefähr 100 Kilometer südlich von Oslo, befindet sich eines der merkwürdigsten Gefängnisse der Welt. Es gibt keine Zellen und keine Gitterstäbe. Es laufen auch keine Wachen mit Pistolen oder Handschellen herum. Allerdings gibt es einen Wald aus Birken und Kiefern, eine leicht hügelige Landschaft mit Spazierwegen und um das alles herum eine hohe Stahlwand – eine der wenigen Erinnerungen an die Tatsache, dass hier tatsächlich Menschen eingesperrt sind. Die Bewohner des Gefängnisses, Halden genannt, haben alle ihr eigenes Zimmer. Mit Bodenheizung. Flachbildschirm. Badezimmer en suite. Es gibt Küchen, in denen die Häftlinge selbst kochen dürfen, man isst von Porzellantellern und mit Messern aus rostfreiem Stahl. Halden verfügt auch über eine Bibliothek, eine Kletterwand und ein richtiges Musikstudio, in dem die Bewohner ihre eigenen Platten aufnehmen können. Die Musik wird unter dem Label des Gefängnisses herausgebracht, das sich – kein Witz – Criminal Records nennt. Drei Strafgefangene haben schon an dem norwegischen Gegenstück zu Deutschland sucht den Superstar teilgenommen, und das erste Gefängnismusical ist in der Mache. Tatsächlich ist Halden ein Musterbeispiel für das, was man ein «nicht-komplementäres Gefängnis» nennen könnte. Das Personal spiegelt nicht das Verhalten der Insassen, sondern hält ihnen im Gegenteil die andere Wange hin. Sogar den Schwerstverbrechern. Es gibt zwar eine Isolierzelle, doch die ist noch nie benutzt worden. Die Aufseher tragen nicht einmal Waffen. Oder, wie einer von ihnen bemerkt: «Wir reden mit den Jungs, das ist unsere Waffe.»
Die Aufseher aller norwegischen Gefängnisse, darunter 40 Prozent Frauen, haben eine zweijährige Ausbildung durchlaufen, in der sie gelernt haben, dass Häftlinge auf einen freundschaftlichen Umgang besser reagieren als auf Gängelei und Demütigungen. Die Norweger sprechen hier von einer «dynamic security», um sich von der altmodische «static security» (mit Mauern, Kameras und Gitterstäben) abzugrenzen. In norwegischen Gefängnissen geht es nicht um das Verhindern krimineller Taten, sondern um das Verhindern krimineller Absichten.
Und das Sonderbare ist, dass diese Strategie zu funktionieren scheint.
Im Sommer 2018 wandte sich ein Team aus norwegischen und amerikanischen Wirtschaftswissenschaftlern dieser Frage zu. Sie konnten mit Zahlen belegen, dass die Rückfallquote (die Gefahr, dass ein freigelassener Häftling erneut eine Straftat begeht) durch einen Aufenthalt in einem Gefängnis wie Halden oder Bastøy im Vergleich zu einer gemeinnützigen Arbeit als Ersatzstrafe oder einer Geldbuße in Norwegen um fast die Hälfte sinkt.
Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Exhäftling Arbeit findet, steigt außerdem um 40 Prozent.
Nicht zufällig hat Norwegen die niedrigste Rückfallquote der Welt. Das amerikanische Gefängnissystem hat dagegen eine der höchsten. In den Vereinigten Staaten sitzen 60 Prozent der Gefangenen nach zwei Jahren wieder hinter Schloss und Riegel, in Norwegen sind es 20 Prozent. Beim Gefängnis Bastøy reden wir von einer Rückfallquote von nur 16 Prozent.
Schlussfolgerung: Selbst bei einer konservativen Schätzung zahlt sich für die Staatskasse ein Aufenthalt in einem norwegischen Gefängnis um mehr als das Zweifache aus. Der norwegische Ansatz ist keine naive, sozialistische Ausgeburt.
James Q. Wilson – «Broken Windows»-Theorie
Im Jahr 2015 erschien eine Metaanalyse von 30 Untersuchungen zur Broken-Windows-Theorie. Was zeigte sich? Es gibt keinen Beleg dafür, dass die aggressive Polizeiarbeit unter Bratton das Verbrechen verringert hat.
Über wessen «Ordnung» sprechen wir eigentlich? Während die Zahl der Festnahmen in New York in die Höhe schoss, ging gleichzeitig die Zahl der Berichte über polizeiliches Fehlverhalten durch die Decke.
So entstand ein Quotensystem: Polizeibeamte wurden unter Druck gesetzt, möglichst viele Strafmandate und Vorladungen auszustellen. Man fing sogar an, Vergehen zu erfinden.
Auf dem Papier sah das alles wunderbar aus. Das Verbrechen nahm rasant ab, die Zahl der Festnahmen schoss in die Höhe, und Kommissar Bratton war der Held New Yorks. Doch in Wirklichkeit kamen zahllose Kriminelle unbehelligt davon, und Tausende von Unschuldigen wurden verdächtigt. Bis zum heutigen Tag sind immer noch unzählige Polizeidienststellen im Bann der Bratton’schen Philosophie gefangen, sodass Wissenschaftler die amerikanischen Polizeistatistiken weiterhin für nicht vertrauenswürdig halten. Und das ist noch nicht alles. Der Broken-Windows-Ansatz hat sich auch als ein Synonym für Rassismus erwiesen. So hatten nur 10 Prozent der Personen, die wegen eines unbedeutenden Vergehens verhaftet wurden, eine weiße Hautfarbe.
Sollten wir zerbrochene Fensterscheiben dann besser nicht reparieren? Natürlich sollten wir das. Es ist eine prima Idee, Fenster zu reparieren, Häuser zu renovieren und sich die Sorgen der Bewohner des Viertels genau anzuhören. So wie ein anständiges Gefängnis Vertrauen ausstrahlt, so fühlt man sich in einem sauberen Stadtteil auch ein Stück sicherer. Und wenn man Fenster repariert, kann man sie anschließend öffnen. Doch in dem größten Teil der Darlegungen Wilsons und Kellings ging es nicht um kaputte Fenster oder schlecht beleuchtete Straßen. Die «zerbrochene Fensterscheibe» war eine irreführende Metapher.
In Norwegen – wo sonst – gibt es eine lange Tradition der «community policing». Dabei handelt es sich um eine Polizeistrategie, die davon ausgeht, dass die Menschen im Grunde gut sind.
Ostrom und ihr Team entdeckten, dass kleinere Polizeiwachen immer wieder bessere Ergebnisse erzielten als die größeren. Ihre Polizisten waren schneller vor Ort, klärten mehr Verbrechen auf, hatten eine bessere Beziehung zur Bevölkerung in ihrem Bezirk – und das für weniger Geld. Besser, menschlicher, preisgünstiger. In Europa wird die Philosophie des community policing schon länger angewandt. Polizeibeamte sind es gewohnt, mit Sozialarbeitern zusammenzuarbeiten, und sehen sich selbst als eine Art Sozialarbeiter. Sie sind außerdem bestens qualifiziert. In den USA ist die Polizeiausbildung durchschnittlich nach nur 19 Wochen abgeschlossen, was in den meisten europäischen Ländern undenkbar wäre.
Zwischen 1972 und 2007 wuchs die Gefängnispopulation in den Vereinigten Staaten – korrigiert um das Gesamtbevölkerungswachstum – um mehr als 500 Prozent. Gefangene in den USA verbleiben durchschnittlich 63 Monate in Haft, siebenmal so lange wie in Norwegen. Inzwischen sitzt fast ein Viertel aller Häftlinge weltweit hinter amerikanischen Gittern.
Bregman, Rutger. Im Grunde gut: Eine neue Geschichte der Menschheit (German Edition) (S.377). Rowohlt E-Book. Kindle-Version.
Der amerikanische Professor vermutete, dass Vorurteile, Hass und Rassismus aus einem Mangel an Kontakt entstehen. Wir generalisieren wild drauflos, wenn es um Fremde geht, weil wir sie nicht kennen. Und somit liegt die Lösung auf der Hand: Wir müssen mehr Kontakt aufnehmen.
Pettigrew und seine Kollegen hatten 515 Studien aus 38 Ländern gesammelt und analysiert. Die Schlussfolgerung: Kontakt funktioniert. Mehr noch, es gibt nur wenige Ansätze in der Sozialwissenschaft, für die es mehr Beweise gibt. Kontakt führt zu mehr Vertrauen, mehr Zusammengehörigkeitsgefühl und mehr gegenseitiger Hilfsbereitschaft. Er hilft dabei, die Welt mit den Augen eines anderen zu sehen. Und er verändert die Persönlichkeit: Menschen mit einem diversen Freundeskreis sind auch Fremden gegenüber toleranter. Kontakt ist außerdem ansteckend: Wer sieht, dass sein Nachbar ein gutes Verhältnis zu anderen hat, beginnt, an seinen Vorurteilen zu zweifeln. Was sich aber auch in diesen Studien zeigte, war, dass eine einzige negative Erfahrung (ein Zusammenstoß, ein böser Blick) größeren Einfluss hat als ein Scherz oder eine helfende Hand. So funktioniert unser Gehirn nun einmal. Anfangs standen Pettigrew und seine Kollegen daher auch vor einem Mysterium: Wenn wir negativen Kontakt besser im Gedächtnis behalten, wie kann uns Kontakt dann trotzdem näher zueinanderbringen? Letztlich lag die Erklärung auf der Hand: Jedem ärgerlichen Vorfall steht ein Berg heiterer Interaktionen gegenüber. Das Böse ist stärker, aber das Gute kommt häufiger vor.
Gewaltloser Widerstand ist sehr viel effektiver als gewaltsamer Widerstand.
Es zeigte sich, dass über 50 Prozent der friedlichen Kampagnen erfolgreich waren, gegenüber 26 Prozent der gewaltsamen. Der wichtigste Grund hierfür, hielt Chenoweth fest, bestände darin, dass sich mehr Menschen an dem gewaltlosen Widerstand beteiligten.
Bei einer friedlichen Kampagne ist ein Aspekt essenziell: Selbstbeherrschung.
Zwei Soziologen entdeckten, dass «die rassische und ethnische Isolation von Weißen» einer der wichtigsten Gründe für die Unterstützung Trumps war. Mehr noch, je weiter man sich von der Grenze zu Mexiko entfernt, umso mehr Unterstützung gab es für den Mann, der dort eine hohe Mauer bauen wollte.Das heißt, das Problem bestand nicht darin, dass Trump-Wähler zu viel Kontakt zu Muslimen und Flüchtlingen hatten.
Es reicht längst nicht aus, in einem gemischten Stadtteil zu leben. Wenn man selten oder nie mit den Nachbarn redet, kann Diversität sogar zu mehr Vorurteilen führen.
Eine der wichtigsten Erkenntnisse der «Kontakt»-Wissenschaftler lautet, dass sich Vorurteile nur beseitigen lassen, wenn wir unsere Identität bewahren. Wir dürfen die Erfahrung machen, dass wir anders sind und dass daran nichts Falsches ist. Unsere Identität darf ein Haus mit starkem Fundament sein. Und dann können wir die Türen öffnen.
Auch wir werden von Demagogen und Hasspredigern gegeneinander ausgespielt. Zeitungen wie die Daily Mail schrieben seinerzeit über blutrünstige Hunnen, heute schreiben sie über Invasionen stehlender, mordender und vergewaltigender Flüchtlinge, die uns unsere Jobs wegnehmen, zu faul zum Arbeiten sind und uns unterdessen Sankt Nikolaus und den Weihnachtsmann vermiesen. So wird der Hass wieder in die Gesellschaft hineingetragen. Und diesmal nicht nur über Zeitungen, sondern auch über Blogs und Tweets, mit Lügen in den sozialen Medien und giftigen Reaktionen auf Nachrichtenmeldungen. Selbst der beste Faktenchecker scheint machtlos gegenüber den Ressentiments und der Feindschaft, von denen wir an manchen Tagen regelrecht überschwemmt werden. Doch was wäre, wenn es auch andersherum funktionieren würde? Was wäre, wenn uns Propaganda nicht nur gegeneinander aufhetzen, sondern wieder zusammenbringen könnte?
Kolumbien, Guerillakämpfer FARC
Je weiter man sich von der Front entfernte, umso größer wurde der Hass. «Menschen, die nie vom Krieg betroffen waren, sind meist die schlimmsten Hardliner», erzählt Jose. Aber wer selbst gekidnappt worden ist oder Freunde und Angehörige verloren hat, möchte die Vergangenheit hinter sich lassen. Die Werbefachleute beschlossen, die Geschichte dieser letzten Gruppe in den Mittelpunkt zu stellen. Sie taten so, als würde ganz Kolumbien die Rebellen mit offenen Armen empfangen, weil sie hofften, dass daraus eine sich selbst erfüllende Prophezeiung werden könnte. Und es funktionierte. Seit 2010 sind Tausende von Guerilleros nach Hause zurückgekehrt. Anfangs hatte die FARC noch 20.000 Mitglieder, doch ein paar Jahre später waren davon weniger als die Hälfte übrig.
Wer Gutes sät, wird auch Gutes ernten.
Wer an das Gute im Menschen glaubt, ist kein Weichei oder ein Naivling. Wer an Frieden und Vergebung glaubt, ist im Gegenteil mutig und realistisch.
Es ist eine alte Wahrheit. Von den schönsten Dingen im Leben bekommt man nur dann mehr, wenn man sie verschenkt: Vertrauen, Freundschaft, Frieden.
Zehn Lebensregeln
Wer die jüngsten Erkenntnisse der Psychologie und Biologie, der Archäologie und der Anthropologie, der Soziologie und der Geschichtswissenschaft studiert, gelangt zu dem Schluss, dass der Mensch über Jahrtausende hinweg ein falsches Selbstbild kultiviert hat. Lange haben wir angenommen, dass der Mensch ein Egoist sei, ein Tier oder Schlimmeres. Lange haben wir geglaubt, dass es sich bei der Zivilisation nur um eine dünne Schicht handele, die beim geringsten Anlass reißen würde. Dieses Menschenbild und dieser Blick auf unsere Geschichte haben sich als völlig unrealistisch erwiesen.
Sobald wir glauben, dass die meisten Menschen gut sind, ändert sich nämlich alles. Wir können unsere Schulen und Gefängnisse, unseren Rechtsstaat und unsere Demokratie vollkommen anders organisieren. Und wir selbst können auch ein anderes Leben führen.
I. Geh im Zweifelsfall vom Guten aus
Im 1. Kapitel haben wir gesehen, dass Menschen einen «negativity bias» haben. Eine einzige negative Bemerkung berührt uns mehr als zehn Komplimente. (Das Böse ist stärker, aber das Gute kommt häufiger vor.) Und im Zweifelsfall neigen wir dazu, vom Schlechten auszugehen.
Wenn du jemandem zu Unrecht vertraust, merkst du es früher oder später schon. Doch wenn du jemandem einmal nicht vertraust, wirst du nie erfahren, ob dein Misstrauen berechtigt war, denn du bekommst kein Feedback mehr.
Man solle besser einkalkulieren, dass man hin und wieder betrogen werde, schrieb sie. Das sei ein kleiner Preis für ein ganzes Leben, in dem man anderen mit Vertrauen gegenübertreten dürfe.
II. Denke in Win-win-Szenarien
Das Gute fühlt sich so oft gut an, weil es auch gut ist.
Verzeihen ist nicht nur ein Geschenk, es ist auch ein guter Deal. Denn der, der verzeiht, muss weniger Energie auf Hass und Neid verschwenden.
III. Verbessere die Welt, stelle eine Frage
Wir können nicht immer gut nachempfinden, was der andere will.
Journalismus bestehen noch größtenteils aus einer Einbahnstraße.
IV. Zügle deine Empathie, trainiere dein Mitgefühl
Im Gegensatz zur Empathie kostet Mitgefühl keine Energie.
Mitgefühl verleiht Energie.
Wenn ein Kind sich vor der Dunkelheit fürchtet, möchte man als Elternteil nicht die Angst seines Kindes empfinden und in einer Zimmerecke weinen (Empathie). Nein, man möchte trösten und beruhigen (Mitgefühl).
V. Versuche, den anderen zu verstehen, auch wenn du kein Verständnis aufbringen kannst
Unser Verstand ist keine dünne Schicht, die unsere emotionale Natur bedeckt. Er ist ein wesentlicher Bestandteil dessen, wer wir sind. Er macht uns zum Menschen.
Jemanden zu verstehen muss natürlich nicht bedeuten, dass man auch Verständnis für ihn aufbringt. Man kann einen Faschisten, einen Terroristen oder einen Liebhaber von Tatsächlich … Liebe sehr gut verstehen, ohne den Faschismus, den Terrorismus oder die Kulturbarbarei gutzuheißen. Jemanden auf rationaler Ebene zu verstehen ist eine Fertigkeit. Vergleichbar mit einem Muskel, den man trainieren kann.
Ich habe argumentiert, dass der Mensch sich in der Evolution zu einem durch und durch freundlichen Wesen entwickelt hat, aber manchmal ist gerade diese Freundlichkeit das Problem. Die Geschichte lehrt uns, dass der Fortschritt häufig bei Menschen wie Jos de Blok vom Pflegedienst Buurtzorg und Sjef Drummen von der Agora-Schule beginnt, die als quengelnd oder sogar unfreundlich erlebt werden. Menschen, die den Mut haben, sich auf Partys und Feiern ungesellig zu verhalten. Die unangenehme Themen anschneiden und einem ein unbehagliches Gefühl vermitteln. Diese Menschen muss man hegen und pflegen, denn sie bringen uns weiter.
VI. Liebe deinen Nächsten, so wie auch andere ihre Nächsten lieben
Menschen sind ihrem Wesen nach beschränkt. Wir machen uns mehr aus Artgenossen, die uns ähneln. Die gleiche Sprache, das gleiche Äußere, der gleiche Hintergrund.
Distanz der Handlanger des Bösen ist. Distanz lässt uns im Internet gegen Fremde wüten. Distanz hilft Soldaten dabei, ihren Widerwillen gegen Gewalt zu umschiffen. Distanz hat die größten Verbrechen der Geschichte ermöglicht, von der Sklaverei bis hin zum Holocaust.
Als Mensch macht man nun einmal Unterschiede. Man bevorzugt und hängt sich an den, der einem nahesteht. Das ist nichts, für das man sich schämen müsste. Im Gegenteil, es macht uns zu Menschen. Das Einzige, was uns dabei klar sein muss, ist, dass auch die Fremden, weit weg, Angehörige haben, die sie lieben. Dass sie ebenso gute Menschen sind wie wir.
VII. Meide die Nachrichten
Derzeit bilden die Nachrichten eine der größten Quellen der Distanz. Wenn man sich die Fernsehnachrichten anschaut, gewinnt man den Eindruck, der Wirklichkeit näher zu kommen, bekommt aber in Wahrheit ein verzerrtes Bild vorgesetzt. Es wird oft in generalisierender Weise über Gruppen von Menschen gesprochen: «Flüchtlinge», «Rassisten», «Eliten» oder «Politiker». Außerdem sind die Nachrichten auf Ausnahmen fokussiert, und zwar meistens auf die negativen.
Die digitalen Plattformen verdienen am meisten, wenn Menschen sich so gemein wie möglich verhalten.
Auf diese Weise sind soziale Medien zu Maschinen entartet, die unsere schlechten Seiten so weit es nur geht vergrößern. Neurologen weisen darauf hin, dass unser Bedürfnis nach Nachrichten und Push-Meldungen stark einer Sucht ähnelt.
VIII. Prügele dich nicht mit Nazis (oder: Strecke deinem größten Feind die Hand hin)
Wenn man regelmäßig die Nachrichten verfolgt, kann man leicht den Mut verlieren. Welchen Sinn ergibt es, nachhaltig zu leben, brav seine Steuern zu zahlen und für einen guten Zweck zu sammeln, wenn andere sich selbst einen Dreck darum scheren? Sollte man sich solchen Gedanken hingeben, wäre zu bedenken: Zynismus ist ein anderes Wort für Faulheit. Es ist eine Entschuldigung, sich zurückzulehnen.
Wer meint, dass die meisten Menschen verdorben sind, braucht sich nicht über Unrecht aufzuregen. Die Welt ist dann sowieso dem Untergang geweiht. Es gibt eine Form des Aktivismus, die verdächtig dem Zynismus ähnelt. Dabei geht es um den Typus des «Weltverbesserers», der vor allem mit dem eigenen Image beschäftigt ist. Sollte man dahin tendieren, verwandelt man sich in den Rebellen, der weiß, was für den anderen gut ist, ohne dass er sich etwas aus dem anderen macht. Dann werden schlechte Nachrichten sogar zu guten Nachrichten, denn schlechte Nachrichten «Die Erde heizt sich noch schneller auf!», «Die Ungleichheit ist noch größer als gedacht!») beweisen, dass man immer schon recht hatte.
IX. Oute dich, schäme dich nicht für das Gute
Wenn man annimmt, dass die meisten Menschen Egoisten sind, ist das Gute grundsätzlich verdächtig.
X. Sei realistisch
Zum Schluss meine wichtigste Lebensregel. Wenn ich mit diesem Buch eines habe erreichen wollen, dann das, die Bedeutung des Wortes «Realismus» zu verändern. Ist es nicht vielsagend, dass in unserem Sprachgebrauch «der Realist» zum Synonym für den Zyniker geworden ist? Für jemanden mit einem düsteren Menschenbild? In Wirklichkeit ist gerade der Zyniker weltfremd. In Wirklichkeit leben wir auf dem Planeten A, auf dem Menschen zutiefst zum Guten neigen. Seien Sie also realistisch. Outen Sie sich. Folgen Sie Ihrer Natur und schenken Sie Vertrauen. Schämen Sie sich nicht für Ihre Großzügigkeit und tun Sie das Gute bei hellem Tageslicht. Vielleicht werden Sie zunächst noch als töricht und naiv abgetan. Doch bedenken Sie: Die Naivität von heute kann die Nüchternheit von morgen sein. Es ist Zeit für ein neues Menschenbild. Es ist Zeit für einen neuen Realismus.



Vielen Dank zunächst für die ausführliche Übersicht über den Inhalt des Buches.
Es entsteht jedoch der Eindruck, dass der Autor des Buches einem Bestätigungsfehler aufgesessen ist bzw. seine Beispiele sehr selektiv ausgewählt hat, um seine Hypothese zu bestätigen. In Gesellschaften, die von starken sozialen Bindungen und einem hohen Maß an Identifikation mit dem Gemeinwesen geprägt waren, mag Krieg z. B. die vom Autor aufgeführten Reaktionen in der Bevölkerung bzw. eine Zunahme der Solidarität nach sich ziehen. Es lassen sich aber zahlreiche gut dokumentierte Gegenbeispiele finden, auf die der Autor offenbar nicht eingeht. Allgemeine Erkenntnisse lassen sich aus einer derart selektiven Auswahl kaum schlussfolgern.
Als fragwürdig erscheint auch der Vergleich der Gefängnissysteme in Norwegen und den USA. Hier scheint der Autor kulturelle Faktoren völlig außer Acht zu lassen. Ob der norwegische Ansatz bei amerikanischen Gefangenen funktionieren würde, ist aber zweifelhaft. Am Beispiel Großbritanniens kann man sehr gut beobachten, wie kulturelle Veränderungen in der Gesellschaft Anpassungen bzgl. der Arbeit der Polizei erforderten, deren ursprünglich eher defensives Auftreten unter jüngeren Männern zunehmend als Ausdruck von Schwäche wahrgenommen wurde. In Deutschland beobachtet die Polizei ähnliches, wie u. a. der Polizeiforscher Rafael Behr beschrieben hat. Man darf annehmen, dass dies auf den Umgang mit Gefängnisinsassen zumindest bedingt übertragbar ist. Die Relevanz solcher kulturellen Unterschiede kann man auch an anderen Beispielen beobachten, etwa bei Vorfällen mit Schusswaffen in der Schweiz und den USA, die beide über ein relativ liberales Waffenrecht verfügen, was aber aus kulturellen Gründen stark unterschiedliche Auswirkungen auf die öffentliche Sicherheit hat.
Nicht dem Stand der Forschung entspricht zudem, was der Autor über NS-Täter schreibt. Diese waren keinesfalls überwiegend Fanatiker, wie z. B. Christopher Browning in seiner Studie über eine an extremen Verbrechen gegen die Menschlichkeit beteiligten Reserve-Polizeieinheit nachwies. Die Täter seien überwiegend „ganz normale Männer“ gewesen.
Die Liste der nur aus der oben wiedergegebenen Zusammenfassung sichtbar werdenden Mängel ließe sich weiter fortsetzen. Im Ernstfall würde ich mich daher nicht darauf verlassen wollen, dass die Behauptungen des Autors zutreffen. Dessen Ratschläge wie „Geh im Zweifelsfall vom Guten aus“ sind im Übrigen verantwortungslos und gefährlich. Viele Opfer von Straftaten wünschen sich nachträglich, sie hätten diesen Fehler nicht gemacht.
Vielen Dank für Ihren kritischen Kommentar!
Es gibt sicher genügend Gegenbeispiele, da bin ich bei Ihnen. Aber ich denke schon auch, dass es relevant ist, welchen Wolf wir füttern. Nämlich bereits vor den Krisenzeiten und natürlich gibt es gewisse kulturelle Unterschiede, die sich eben dann in die eine oder andere Richtung auswirken. Mein Ansinnen ist es, dass es nicht eindeutig sofort ins Negative geht, keinesfalls, dass wir naiv sein sollten.
Nur wenn sich alle sofort zurückziehen und sich nur mehr um die eigene „Verteidigung“ kümmern, wird das ganze wesentlich schneller kippen, als wenn man versucht, die Probleme gemeinsam zu lösen.
Auch am Balkan sind die Einzelkämpfer ausgestorben und Gruppen haben überlebt.